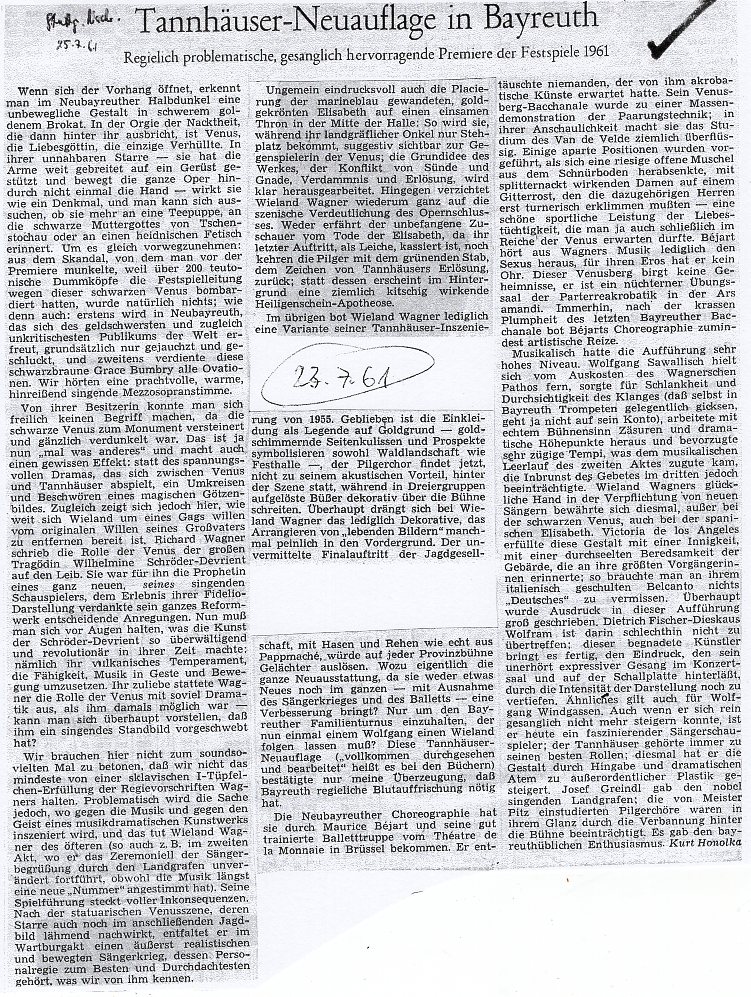Zur Oper am 23. Juli 1961 in Bayreuth
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Datum unbekannt
"Tannhäuser" halb-analytisch
Die Eröffnung in Bayreuth
[...]
Wieland Wagners Bühnenbilder, sehr delikat, sensibel bis zum Ästhetizismus, gefallen in ihrem klugen Verzicht auf anekdotische Lokalisierung, zumal durch geistreiche Sparsamkeit, in den weiträumigen Schauplätzen voll von zarter Spannung einer vergrößerten Miniatur. Liebeshof in Avignon oder Brüssel. Die Bäume des Thüringer Waldes sind umgesetzt in ein lichtes Muster von sanftem Gezweig. Die "teure Halle" aber wird auf dem Grund der nämlichen Kulisse, durch ein Muster romanischer Bogenstellung im Rapport eher angedeutet als grob verwirklicht. Das läßt der Fantasie des Betrachters einen wünschbaren angenehmen weiten Spielraum, aber es ist zugleich, wie sich zeigte, bis zum Scheitern bedroht vom Eigenwert der Kostüme.
Diese aber (Kurt Palm), obzwar bravourös geschnitten, schienen in ihrer auftrumpfenden Farbe mitunter wie einer Schachtel Pralinen entstiegen. Da war genau das gleißende Gold, das ein Rot oder Blau zum Plakatschmuck entwürdigt. Auf Momente verwandelte sich der so schwebende, immaterielle, lichtgoldene Raum zum Ort einer Weihnachtsbescherung mit allen Schikanen. Duftend nach Eau de Cologne. Das aber war um so mehr zu bedauern, als der Regisseur – Augenblicke zuvor oder hinterher – den gleichen Raum mit visionär leichten Andeutungen geistreich zu beseelen vermochte. Der Pilgerchor, aufgelöst in eine Folge einzelner, silhouettenhafter Gruppen, ist da an erster Stelle zu rühmen.
Ob es im Ganzen, was das Bild betrifft, an existenziellen Störungen fehlte? Immerhin war der Sängerkrieg, eine Art Rundlauf um Elisabeths Thron, glänzend akzentuiert, ohne daß sich, wie so oft bei Sängern, in der Geste des Zeichnens Verismus vordrängte. Störung als Absicht und Akzentuierung wurde auch innerhalb des Venusbergs deutlich. Der Regisseur hatte die dunkle Sängerin Grace Bumbry geradezu zum Idol herausgeputzt – bis auf das nicht eben schöne Kostüm (neureich im Geschmack), wahrhaft das Standbild einer Astarte. Und gegen dieses bekleidete Standbild brandete stürmisch und wirbelig, in großartig disziplinierter Wildheit Maurice Béjarts virtuos nackte Brüsseler Gruppe in mehrfachen Wellen des Angriffs an. Daß Béjart dann nicht nur tanzen, sondern auch klettern ließ, war zu erwarten. Die andere Hälfte seiner Truppe, in das Höllenmaul eines Netzes gehängt, wurde von oben herabgelassen. Es war Gelegenheit genug, Exerzitien der Vereinigung – gehüllt in halbes Licht – vorzuführen. Sawallisch am Pult sorgte für angenehm zügige Tempi und suchte gemeinhin zu egalisieren.
Es ist die Frage, ob diese Oper heute noch "kantabel", im alten, geschlossenen, runden Geschmack vorzuführen ist – oder ob es nicht erlaubt, wenn nicht gar notwendig sei, sie unseren "offenen" Nöten anzunähern. Von der Gegenwart her schien die intelligente, gelegentlich harte und rüde Frische, mit welcher Miß Bumbry die Venus sang, durchaus sympathisch und überzeugend. Sympathisch auch in ihrer beseelten, exakten, hochgespielten Feinheit die Elisabeth der Victoria de Los Angeles. Daß sich Wolfgang Windgassen (Tannhäuser) erst im zweiten Akt als der souveräne Kenner seines Parts bewies, als welcher er seit langem gilt, mag als Premieren-Nervosität begreiflich sein. Daß aber auch der so gefeierte Orpheus des deutschen Liedes – Fischer-Dieskau – als Wolfram hie und da seine Kunst der Phrasierung vermissen ließ, war um so eher bedauerlich, als gerade er wie sonst keiner das Parlando des raunenden Halbtons besitzt. Er hat die Dringlichkeit auch der Schatten, wie sie heute, im Zeitalter Samuel Becketts, gegen den Pomp der halben Lüge, den Krampf der ideologischen Rettung, unsere Wahrheit vertreten muß. Diese Wahrheit, als Führung der Stimme, war aus Gerhard Stolzes Walter zu hören. Sie war auch in der schlichten Natur von Josef Greindls Landgraf Hermann.
Mag man sich also summa summarum eine andere Deutung des Werkes ausdenken können: heiter und analytischer oder (im Sinne von Wieland Wagner) noch sublimer und gegenstandsloser – das Publikum im Festgewand, im Straß und Brokat und weißem Smoking, erhielt seine derzeitige Vorstellung von Kunst gleichsam halboffiziell bestätigt. Es jubelte, der Dämonen ledig. Askese, so harmonisch gefeiert, tut dem Gemüt und den Nerven wohl.
Albert Schulze-Vellinghausen
Süddeutsche Zeitung, Datum unbekannt
Der neue Tannhäuser – zwischen Ornament und Psychologie
Die Eröffnungs-Premiere der Bayreuther Festspiele 1961
In Wieland Wagners "Tannhäuser"-Inszenierung von 1954 gab es am Schluß des zweiten Akts jenen großartigen Moment, da die ganze Ritterschaft, der Landgraf, die Sänger und die Edeln, als Tannhäuser mit dem Ruf "Nach Rom!" aus der Halle gestürzt ist, in einem weiten Halbkreis vor Elisabeth hintraten und sich vor ihr verneigten. Sinnfälliger konnte die Idee der "Minne", der "Hohen Liebe", von der Wolfram singt (als Gegensatz zum niederen Sinnentaumel des Venusbergs), nicht ausgedrückt werden als durch diese Huldigung vor der Fürbitterin durch die, die das Schwert gegen eben jenen zückten, für den sie bittet. Das war ein Augenblick großer, erhellender Regie, in dem Gestaltung und Deutung, Bild und Sinn in eins gesetzt wurden, so daß das Sinnbild entstand.
In der Neuinszenierung, mit der die Bayreuther Festspiele 1961 eröffnet wurden, gibt es diesen Augenblick nicht mehr. Die Ritter stehen am Schluß in vollkommen symmetrischer Ordnung noch auf demselben Platz, auf den sie die Regie bei ihrem Einzug gestellt hat, die Sänger fallen, als – wie mit einem Lichtstrahl tröstlicher Hoffnung – der fromme Sang der Pilger hereindringt, aufs Knie, und ganz vorn sinkt Elisabeth, während der Vorhang fällt, ohnmächtig zu Boden. Die Kombination von ornamentalem Arrangement (die Ritter) und psychologischem Akzent (Elisabeths Zusammenbruch nach der Nervenstrapaze während Tannhäusers Schuldbekenntnis und Verdammung) ist bezeichnend für die beiden Komponenten, auf denen Wieland Wagners Neuinszenierung beruht und in deren Verbindung Widersprüche und Zwiespältigkeiten zutage treten.
*
Es beginnt beim Venusberg. Die Muschel, die seinerzeit als Schauplatz ein eingängiges Zeichen für die "schlammige" Natur der Liebesorgien war, ist verschwunden. Ein riesiger, silbrig glitzernder Schwamm schimmert aus der Tiefe der Bühne, an deren vorderem Rand, in ein goldenes Gewand gehüllt, Goldflecken auf der dunklen Haut, auf einer Art Estrade regungslos die schwarze Venus sitzt – ein Idol der Hölle, das an hetärische asiatische Göttinnen denken läßt und den Zuschauer ebenso fasziniert, wie ihn das sie umtobende Bacchanal der Pariser Fassung verwundert.
Sagte ich eben "umtobend"? Das Wort muß mir in den Sinn gekommen sein, weil ich noch einmal nachlas, was Richard Wagners im Brünstigen wie im Inbrünstigen gleichermaßen schwelgerische Phantasie sich bei diesem kallisthenischen Hexensabbat – gewiß mehr als Vision denn als buchstäblich zu befolgende Regieanweisung – vorgestellt hat. Aber was sich Maurice Béjart dabei mitsamt dem – etwa als Erinnerung an Hieronymus Boschs Madrider "Garten der Lüste"? – von oben herabschwebenden, mit lasziver Weiblichkeit angefüllten Ei für sein die Bayreuther Bühne mit einem Lustschrei in Besitz nehmendes Brüsseler Ballet du vingtième Siècle ausdachte, ist in seiner raffiniert erklügelten und mit höchster artistischer Virtuosität produzierten Formalistik alles andere als ein Toben. Die Gewagtheit der "Positionen", in denen sich die Paare umschlingen, wird aufgehoben durch exakten tänzerischen Drill; das ist kommandierte Brunst, sterile Glut. Das ist keine Entfesselung der Wollust, sondern eine Trainingsstunde für erotische Gymnastik (wenn auch, zugegeben, für Fortgeschrittene). Aber geht es hier nicht gerade um etwas Ur-Anfängliches, Regelloses und Elementares, ja Chaotisches? Um etwas, das weltenweit entfernt ist von allen "Ordnungen", wie sie die höfisch-gesittete Liebeskunde der Minnesänger aufstellt? Mir scheint, die Tendenz zur Formalisierung, die den neuen Bayreuther "Tannhäuser" auf weite Strecken bestimmt, hat hier den Inszenator und seinen Choreographen das entscheidend Diametrale in der Grundkonzeption dieser "romantischen Oper" übersehen lassen. (Abgesehen davon, daß man sich für die Erscheinung der Venus und ihres buhlerischen Gefolges im dritten Akt denn doch etwas mehr teuflischen Zauber und abraxische Höllenrevue hätte wünschen mögen, als sie die etwas kahle Repetition jener eingangs als Bacchanal gezeigten Gymnastikstunde bot.)
Tendenz zur Formalisierung: Der Auftritt der Pilger, in der blockhaften Geschlossenheit des schwerschrittigen Zugs quer über die Bühne einer der stärksten Momente der früheren Inszenierung, ist nun aufgelöst in einander folgende, ein Kreuz tragende Dreiergruppen und ekstatisch schreitende Einzelgänger – eine in der Gruppenkomposition schöne, aber in der Wiederholung starre Ornamentik ist an Stelle der die Schwere der Sündelast sinnfällig verdeutlichenden schleppenden, geduckten Bewegung von einst getreten. Es verstärkt den ornamentalen Eindruck noch beträchtlich, daß die über die Bühne Schreitenden nur stumme Figuranten sind, während der Chor unsichtbar hinter der Szene singt. Verschwunden ist auch das riesige Kreuz, das früher als christliches Weltzeichen (gegenüber der heidnischen Unterwelt) nach der Verwandlung des Venusbergs in das Wartburg-Tal das Bild beherrschte. Das "Tal" ist, die Raumkonzeption von 1954 fortentwickelnd, jetzt ein saalartiger, mattgoldner Raum, den drei streng stilisierte Bäume vor der Rückwand als "Landschaft" charakterisieren. Es ist die Welt der Manessischen Liederhandschrift, die – eine Vorliebe Wieland Wagners – hier ins Bühnenbild übertragen wird, im dritten Akt ist es in ein tiefes Dunkelgold, die Farbe des glühenden Herbsttodes, getaucht. Die Umwandlung in den Sängersaal des zweiten Akts geschieht durch Folien mit dem Motiv des romanischen Rundbogens, die über die Wände gehängt werden, und einen hohen, schmalen Sessel für Elisabeth, "des Festes Fürstin", die damit – fast an der gleichen Stelle, wo vorher Venus thronte – als Herrin des Minnehofs ins Zentrum des Bildes gerückt ist. Der Landgraf muß während des ganzen Sängerstreits nicht nur stehen, sondern auch als eine Art Kampfleiter fungieren, der den Sängern Rede und Gegenrede zuweist; ob das der repräsentativen Bedeutung der Gestalt ("Der holden Kunst Beschützer") ganz entspricht, erscheint fraglich,.
*
Ornament und Psychologie stehen im zweiten Akt dicht nebeneinander. Ornament ist der Einzug der Gäste in einheitlich blauen Gewändern mit violettem Überwurf, in choreographisch geordnetem seitlichem Schreiten, in preziös-zeremonieller Haltung: verfeinertes, ja vielleicht dekadentes Mittelalter. Psychologie ist der Wettkampf der Sänger, beginnend mit Tannhäusers Widerspruch gegen Wolframs Auffassung vom Wesen der Liebe, in sich steigernder Unruhe, die Mißtrauen und dann offene Empörung gegen den Frevler aus dem Venusberg wird, zurückwirkend auf Elisabeth, die aus angstvoller Liebe und tiefstem Entsetzen wie in einer Vision die Kraft gewinnt, sich allein der gesamten Ritterschaft entgegenzustellen. Das ist, mit intensivster Spannung erfüllt und zu wahrhaft dramatischer Zuspitzung getrieben, ein Höhepunkt der Aufführung, der indessen nach Tannhäusers Schuldbekenntnis durch sein allzu häufiges In-die-Knie-Sinken und Zu-Boden-Stürzen rasch abgeschwächt wird; hier, scheint es, mußte die regieliche Konzeption der theatralischen Konvention das Feld überlassen.
Wie merkwürdig, daß Wieland Wagner im Gegensatz dazu die große, von einem mächtigen lyrischen Espressivo durchströmte Szene im ersten Akt, in der die Sänger ihren einstigen Gefährten Tannhäuser wiedererkennen, ohne jede Spielaktion völlig statuarisch anordnet und rein oratorisch singen läßt, dann aber im Finale das vergleichsweise unwichtige, nur romantisch-illustrative Moment, daß sich dieses Wiederfinden während einer Jagd begibt, dadurch hervorhebt, daß er das ganze Gefolge mit allen Emblemen und Trophäen feudaler Waidmannslust (als da sind: Hörner, Spieße, metallene Falken und allzu wohlverpacktes Wildbret) auf die Bühne kommen läßt. Nicht zu bestreiten, daß das wiederum als Ornament äußerst eindrucksvoll ist; kaum aber auch zu verkennen, daß hier der große szenische Akzent auf die dekorative Nebensache gesetzt ist, während die essentielle Hauptsache – die durch Wolframs "Bleib bei Elisabeth!" bewirkte Rückkehr Tannhäusers in den Kreis der Minnesänger – ins bloße Bild zurückgenommen wird. Das ist wohl gegen die dramaturgische Logik, wie es ihr andererseits entspricht, daß Tannhäusers Tod mit der Erscheinung einer Engelschar hoch im Hintergrund – man sieht eigentlich nur die Lichtwelle ihrer Heiligenscheine – apotheotisch verklärt wird; denn sein Tod in den Armen seines ihm in der "orphischen" Natur brüderlich verwandten Freundes Wolfram bedeutet zugleich seine Entsühnung und Erlösung, die nicht auf Erden, wo ihn der Papst verdammt hat, sondern "drüben" vollzogen wird – als Gnade durch die fürbittende Liebe der unter die Seligen entrückten Elisabeth.
Das Formale einerseits bis zum Ornamentalen sublimiert, das Espressive andererseits bis zum Psychologischen zugespitzt – so bietet sich das Bild der neuen "Tannhäuser"-Inszenierung, deren äußerer Widerhall beim Publikum außerordentlich war, die aber die Geschlossenheit ihrer Vorgängerin von 1954 nicht ganz erreicht. Der "reale" zweite Akt ist reich an suggestiven Einzelheiten, tief durchfühlt im Menschlichen, und in der Ausdeutung der inneren Beziehungen zwischen Elisabeth, Tannhäuser und Wolfram ist inmitten des Repräsentationsaufgebots der "Großen Oper" die intime Tragödie herausgespürt und mit einer noblen Verhaltenheit des Affektiven ausgeformt. In den "surrealen" Szenen dagegen ist die Verwandlung souverän zur Wirkung gebrachter Theatralik ins Dämonium und ins Mysterium nur bedingt gelungen.
*
Die drei Frauenpartien waren Sängerinnen anvertraut, die in Bayreuth debütierten. Zuerst muß Victoria de los Angeles als Elisabeth genannt werden: Eine zarte und süße kleine Heilige im blauen Madonnenmantel, von südlicher Anmut der Bewegung und ausdrucksvoll "sprechender" Gebärde, bewältigt sie die das Volumen ihres silbernen Soprans im Grund überfordernde Partie mit einer stupenden musikdramatischen Intelligenz, und eben das Silbrige im Timbre ihrer Stimme setzt sie instand, sich über das gewaltige Männerensemble im zweiten Akt strahlend hinwegzuschwingen. Das vorangehende Duett mit Wolfgang Windgassens dramatisch großartigem, in der Rom-Erzählung durch die Kraft und Konzentration des Ausdrucks erschütterndem Tannhäuser hatte eine hinreißende opernhafte Verve, und im Gebet ergriff die Innigkeit der Empfindung.
Grace Bumbry, die faszinierende farbige Venus, hat Feuer und Leidenschaft in der Stimme – übergenug, um alles an dramatischem Ausdruck in sie hineinzulegen, was ihr, der bewegungslos thronenden Astarte, darstellerisch auszudeuten versagt bleibt. Das Dunkle, Fremde, gefährlich Verführerische heidnischer Göttermagie in der christlichen Welt des Mittelalters – in Grace Bumbry fand es eine ungewöhnlich suggestive Verkörperung. Ganz bezaubernd, hell und unbefangen sang die Dänin Else-Margrete Gardelli den heiklen Part des jungen Hirten.
Aus Dietrich Fischer-Dieskaus herrlich gesungenem Wolfram sprach das orphische Geheimnis der versöhnenden Kraft des Gesangs – die andere Seite jener Macht, die sich in Tannhäuser (und Windgassen brachte das in seinem fast frenetischen Preislied auf Venus beim Sängerstreit großartig heraus) nur vernichtend offenbart. Josef Greindl hatte als Landgraf besonders schöne Augenblicke väterlich-gütigen Ausdrucks in der Szene mit Elisabeth. Trefflich als ritterliche Sänger, solistisch wie im Ensemble: Gerhard Stolze, Franz Crass, Georg Paskuda und Theo Adam. Der Chor, wie immer unter der meisterlich obsorgenden Führung von Wilhelm Pitz auf seine große Aufgabe vorbereitet, leistete auf und hinter der Szene Hervorragendes.
Am unsichtbaren Pult stand Wolfgang Sawallisch. Er musizierte mit großem Zug, feinstem Sinn für orchestrale Farben und kammermusikalische Valeurs, mit dramatischem Nerv und der inneren Ruhe für das Lyrische, das im "Tannhäuser" zuweilen noch tief in der Konvention steckt und darum einer besonders sensiblen klanglichen Modellierung bedarf. Die zügigen Tempi, die Sawallisch, ohne je zu übereilen, anschlug, kamen der Partitur, in der Pathos dem jugendlichen Elan schon oft genug in die Zügel zu fallen droht, sehr zugute.
Der Beifall, bereits nach dem ersten und zweiten Akt stürmisch, wollte am Schluß kein Ende nehmen und erzwang noch das Öffnen des Türchens im bereits herabgelassenen eisernen Vorhang.
K. H. Ruppel
Münchner Merkur, 25. Juli 1961
Bayreuther Festspiele
Richard Wagner – beim Wort genommen
Zur Eröffnung: "Tannhäuser" mit einem Bacchanale von Maurice Béjart
Vor sieben Jahren packte, befremdete, begeisterte und schockierte Wieland Wagner durch die Neuinszenierung des "Tannhäuser", die sich rücksichtslos über eine seit hundert Jahren sanktionierte Bühnentradition hinwegsetzte. Jetzt würdigt er das "Gleichnis von der irdischen und himmlischen Liebe", wie man das Drama des ekstatischen Wartburgsängers so bequem gedeutet hat, als erstes Werk Richard Wagners einer zweiten Inszenierung und rückt es damit erneut in den Mittelpunkt der Diskussion.
Außergewöhnliche Kräfte hat Wieland Wagner für diese Aufführung aufgeboten: die gefeierte spanische Sängerin Victoria de Los Angeles, Maurice Béjart, den exzeptionellsten unter den modernen Choreographen, Dietrich Fischer-Dieskau, den besten Wolfram, den es vermutlich je gegeben hat. Dazu den neu entdeckten farbigen Star Grace Bumbry, den einige "Hüter des Hortes" schon vor der Aufführung aus rassischen Gründen zu diffamieren suchten. "Diese Leute, die wahrscheinlich das Werk meines Großvaters gar nicht verstanden haben, geben sich der Lächerlichkeit preis", antwortete ihnen Wieland kurz und bündig.
Es ist nur zu natürlich, daß man die Aufführung ständig mit der älteren vergleicht, zumal ihre Konzeption die gleiche ist. In musikalischer Hinsicht und in der schlechthin großartigen Besetzung übertrifft sie sie, aber Wielands Regie entwickelte seinerzeit mehr Elan und Intensität.
Wieland stellt sich aus den verschiedenen Fassungen, die Wagner dem "Tannhäuser" gab, eine eigene zusammen, die Teile der Dresdner beibehält, wie Walthers Kampflied, sich aber im wesentlichen an die Pariser Bearbeitung vom Jahre 1861 hält, alter Bayreuther Tradition folgend. Ihr Hauptsieg nun ist bekanntlich das mächtig erweiterte Bacchanale. Hier überrascht Wieland durch eine von den sonst üblichen wie seiner eigenen früheren sich weit entfernenden Deutung.
Im Vordergrund eines unterweltlichen Halbdunkels thront, golden bekleidet und goldfarben geschminkt, Venus, statuarisch und monumental gleich einem heidnischen Götzenbild. Sie ist so überhöht, daß ein Riesenabstand zwischen ihr und dem neben ihrem Thronsockel liegenden Tannhäuser klafft. Ihrer Auseinandersetzung mit ihm wird fast das persönliche Aufeinanderbezogensein genommen und damit auch unsere persönliche Anteilnahme. Diese konzentriert sich nun völlig auf das höllische Geschehen dahinter. Und hier ist Maurice Béjart der Meister.
Er entfesselt einen in dieser Nacktheit (im wirklichen wie im übertragenen Sinn) kaum je dagewesenen bacchantischen Taumel, eine mythologische Orgie. Jünglinge und Mädchen tanzen "in wilder Lust" aufeinander zu, zerknäulen sich zu einem Gewoge von Leibern und "der allgemeine Taumel steigert sich zur höchsten Wut". Richard Wagners Regieanweisungen, sonst nur zu gerne umgedeutet, wurden hier einmal beim Wort genommen. Auf dem Höhepunkt gleitet ein Lustgehege vom Schnürboden herab, an dessen Netzen die Paare in gieriger Hast hinaufklettern und in rhythmischen Exzessen hängen.
Béjarts mit grandioser Vehemenz hingelegtes und meisterhaft durchgearbeitetes Bacchanale packt einen zunächst und reizt auf. Aber nur zu schnell erlahmt unser Interesse, und trotz aller zur Schau gestellten Hitze bleiben wir kalt. Der Pas de deux, in dem das Venusberggeschehen 1954 gipfelte, wirkte zuchtvoller, dabei schwüler und doch edler.
Alle übrigen Szenen spielen in einer Einheitsdekoration, einer von riesenhaften Wänden abgegrenzten Fläche, die bald Wartburgtal, bald Wartburghalle darstellt und nur in kleinen Akzidenzien variiert wird. Nicht alle Änderungen in der Regie erweisen sich als Verbesserungen. Der gesenkten Hauptes und schleppenden Schrittes über die Bühne ziehende Pilgerchor von einst hat sich beispielsweise in ekstatische Dreiergruppen aufgelöst. Der Gesang ertönt hinter der Bühne; Augen- und Ohrenerlebnis brechen auseinander.
Der Einmarsch der Gäste verursachte 1954 mit der restlosen Entindividualisierung des Chors einen der größten Neu-Bayreuther Schocks. Im Gleichschritt und militärischer Gruppierung, dazu uniform angezogen, betraten die Gäste die Bühne. Im Jahre darauf verlor der Einzug das Abgezirkelte und wurde eine glänzende Versinnbildlichung höfischen Zeremoniells.
Jetzt hat Wieland Wagner dies alles wieder über Bord geworfen; die Gäste betreten in altgewohnt legerer Art die Bühne. Daneben wieder stehen Rudimente eines starren Stilisierungswillens, etwa wenn während des Sängerstreits alle Männer mit einem Ruck so zackig von den Sitzen schnellen, daß darüber im Publikum vereinzelt sogar gelacht wird. Die Sänger hingegen umkreisen nach Art alter Opernverschwörer schrittweise den mächtig erhöhten Thronsitz der Elisabeth. Ihr Thron nimmt immer den gleichen Raum ein wie zuvor die Venusstatue. Elisabeth und Venus sind nicht so sehr Gegenspielerinnen, sondern die zwei Pole, deren Einswerden erst das von Tannhäuser ersehnte Ideal des Ewig-Weiblichen darstellt.
Als Wielands erste "Tannhäuser"-Inszenierung ausgereift war, stimmten wir eine Lobeshymne auf sie an. Vieles von dem, was wir damals schrieben, gilt auch für den "Tannhäuser" 1961, auch wenn Wieland in seinem Streben, ständig zu erneuern und umzumodeln, bisweilen wieder zurückschreitet oder sich im rein Dekorativen verliert, etwa dem Jagdspektakel als buntkoloriertem erstem Aktschluß. Es ist eben immer die Gefahr bei Wieland, daß er Richard Wagners Musikdrama in eine musikdramatische Revue wandelt.
Unter den Darstellern ist der Wolfram von Fischer-Dieskau bereits bekannt; kaum jemals sah man auf der Opernbühne eine Gestalt, die so viel Würde und Größe besitzt, und wohl nie hörten wir den "Abendstern" mit so viel Wärme, lyrischem Schmelz und zugleich so männlich edler Klangfülle. Ungewöhnlich auch Grace Bumbry als Venus, eine Stimme von ungeheurer Verführung, von berückender Süße im Piano und dämonischer Leidenschaft im Forte. Wahrlich, in ihrem Gesang pulsiert der heiße Atem der Liebesgöttin!
Groß auch Victoria de Los Angeles, wenngleich sie vielleicht bedeutender als Verdi- und Puccini-, denn als Wagnersängerin ist. Auch als Elisabeth verströmt sie die ganze Wärme ihres herrlichen, quellenden Soprans, trifft den Jubel der Liebe wie den Schmerz der zu Tod Getroffenen, gibt der Hallenarie ungewöhnliche Energie, tritt mit dramatischer Geste den auf Tannhäuser eindringenden Männern entgegen und erfüllt das Gebet des dritten Aktes, in zartestem Piano singend, mit hingebendem Ausdruck.
Wolfgang Windgassen, Bayreuths treuester Tenor, ist von Jahr zu Jahr mehr ins Heldisch-Dramatische hineingewachsen. Und es will etwas heißen, neben der hier versammelten Sängerelite der würdige Darsteller des jähen, fahrig-leidenschaftlichen, heftig sinnlichen Tannhäusers zu sein.
In der Wartburgrunde glänzen Franz Crass, Georg Paskuda, Theo Adam, der scharf pointierende Gerhard Stolze als Walther von der Vogelweide und Josef Greindl als stattlicher Landgraf. Viel Poesie legt schließlich Else-Margarete Gardelli in den Frühlingsruf des Hirtenknaben.
Am Pult steht Wolfgang Sawallisch. Er liebt die schnellen und belebten Tempi, sorgt für wohltuende Schlankheit des Klanges, für größte Klarheit und Exaktheit.
Zum Schluß klatschte das begeisterte Publikum fast eine halbe Stunde lang Wieland Wagner und seinen Künstlern zu.
Helmut Schmidt-Garre
Abendzeitung, München, 25. Juli 1961
Goldene Venus auf dem Grünen Hügel
Die Bayreuther Neuinszenierung des "Tannhäuser"
Szenisch ist der Venusberg die gefährlichste Klippe des "Tannhäuser", denn die Musik hat es wesentlich leichter, erotische Orgien unanstößig zu veranstalten als das Bild. Was sich zu dieser genialsten Liebesmusik durch Jahrzehnte an mickriger Armseligkeit und muffiger Einfallslosigkeit in Rosatrikot dargeboten hat, ermißt man erst seit Wieland Wagners Inszenierungen, die diese beschämende Diskrepanz aufhoben.
Béjart, den man hier als einen Geometriker der Erotik bezeichnen könnte, löst die heißesten Dinge technisch mit solcher Virtuosität, daß sie sich fast bis zu rein ästhetischer Wirkung abkühlen. Das Bühnenbild beschränkt sich dabei auf ein Vegetatives schaumiges Gebilde im Hintergrund. Darüber senkt sich auf dem Höhepunkt des Bacchanals ein großes Netz, in das, spinnengleich, nackte Mädchen eingewebt sind, die die Jünglinge anlocken.
Ganz im Vordergrund steht mit seitwärts gestreckten Armen Venus, unbeweglich und goldschimmernd, mehr magisch-priesterliche Astarte als lockende Aphrodite. Es ist Grace Bumbry, üppig, farbig und höchst intensiv in der Stimme, die sie bisweilen an die Grenzen ihrer dynamischen Möglichkeiten trieb.
Ein sehr schönes Bild, an alte goldgegründete Tafelmalereien erinnernd, in prachtvollen Abstimmungen von reinen und gebrochenen Farbtönen der Kostüme, ergab die Sängerhalle. Wenngleich man sich fragt, warum Wieland Wagner die links eintretenden Ritter und Frauen noch immer so eigensinnig nach der rechten Seite streben läßt und umgekehrt, weiß man dieses Zeremoniell doch wegen seiner bestechenden Ausführung und bannenden Wirkung zu schätzen. Victoria de los Angeles, mit den Attitüden gotischer Madonnen vertraut, von rührender Innigkeit der Gestik und Mimik, fesselt durch die Reinheit des Ausdrucks, das goldene Timbre der stimmlichen Mittellage und der schimmernden Höhe, die ihr jedoch bisweilen einige Mühe zu verursachen schien.
Das Bild des Tals im ersten und dritten Aufzug zeigt lediglich golden stilisierte Baumstämme zu beiden Seiten der Bühne, drei hoch aufragende Bäume mit Gebüschkronen im Prospekt und wirkt doch als weite, aber begrenzte Gegend. Den Pilgerchor teilt Wieland Wagner in getrennte Gruppen zu drei Pilgern, einzelne wandeln ihnen, wie verzückt einer Botschaft folgend, voraus. Man denkt an ekstatisch-cherubinische Wanderer, mönchisch-mystische Romantik wird lebendig. Die bannende Großartigkeit dieser Szene wird leider durch die kunstgewerbliche Brillanz des Jagdensembles (Landgraf mit Minnesängern) abgeschwächt.
Der erotische Verführungsspuk, der das Erscheinen der Venus in der letzten Szene begleitet, wirkt allzu ballettmäßig. Nach Tannhäusers Tod singt eine Engelsschar in der Höhe, von goldenen Aureolen umgeben, den Chor der jungen Pilger und hinterläßt den Bildeindruck eines Cinquecentomeisters.
Dietrich Fischer-Dieskau schuf als Wolfram eine eminent noble Charakterpartie und sang hinreißend. Solche Phrasierungskünste stehen heute fast einzig da. Nicht minder hervorragend war Wolfgang Windgassen als Tannhäuser, dessen intelligente Präsenz stets bewunderungswürdig ist. Seine Romerzählung hatte außerordentliche dramatische Wucht. Weiterhin ist die gütige Würde Josef Greindls zu loben, die hochqualifizierten Minnesänger Gerhard Stolze (Walter von der Vogelweide), Franz Crass (Biterolf), Georg Paskuda (Heinrich der Schreiber), Theo Adam (Reinmar von Zweter) und die stimmliche Frische des jungen Hirten Elsa Margrete Gardellis.
Die Chöre unter Wilhelm Pitz sind an Schönheit und Reinheit unvergleichlich. Ebenso optisch genießerisch wie technisch perfekt: das Ballett des Théâtre de la Monnaie in Brüssel. Wolfgang Sawallisch konnte seinem Bayreuther Erfolg durch sein klares, in den Zeitmaßen charaktervolles, klangschönes Musizieren einen neuen hinzufügen.
Mingotti
Berliner Tagesspiegel, 25. Juli 1961
Harmonie des neuen Stils
Eröffnung der Bayreuther Festspiele – Wieland Wagners "Tannhäuser" - Inszenierung
"Tannhäuser" ist unter Richard Wagners Werken eines der vieldeutigsten. So lapidar und einfach die große Antithese von Sinnenlust und Askese ist, die sich als unverwischter Schwarz-Weiß-Kontrast durch Dichtung und Musik hindurchzieht – was hinter diesem elementaren Gegensatz steht, ist um so schwerer zu klären. Der Held, in dem zwei mittelalterliche Dichtergestalten verschmolzen sind; die Göttin Venus, die ebensowohl antike wie keltisch-elbische Züge trägt; Elisabeth, die mit der Heiligen der Wartburg-Legende kaum mehr als den Namen gemein hat: schon die Figuren sind nicht eindeutig, noch weniger der Sinn ihrer Verknüpfung. Das Drama Tannhäusers, der zwischen irdischer und himmlischer Liebe schwankt: es ist die Begegnung der weltfrohen Antike, die schon zum Zauberspuk degradiert ist, mit dem strengen, weltverneinenden Gesetz des christlichen Mittelalters. Ob aber eines das absolut Böse, das andere das absolut Gute, sei, die Frage hat der Musiker Wagner, der die glühende Orgie des Venusberges mit derselben leidenschaftlichen Anteilnahme komponierte wie die dunklen, mystischen Harmonien des Pilgerchores, offengelassen. Der Held ist interessant, weil er sündigt und erlöst wird; seine Beziehung zum Dämonischen hebt ihn aus der Gemeinschaft der Reinen, aber auch über sie hinaus.
Es war darum möglich, daß Wieland Wagner, der vor sechs Jahren zum ersten Mal den "Tannhäuser" in Bayreuth inszenierte, nun eine neue Inszenierung des Werkes auf die Bühne des Festspielhauses stellte, die der früheren in wesentlichen Punkten entgegengesetzt ist. Das ist nicht nur der rasche Wandel der Zeit, die Suche nach Neuem, die die Aktualität des Theaters verlangt, nicht nur die Entwicklung eines Regisseurs, der sich nicht wiederholen will. Es liegt in der Natur gerade dieses Werkes, daß man es von verschiedenen Seiten sehen, auf verschiedene Weise deuten kann. So hatte sich der Regisseur dieses Mal nicht gegen die romantische Opernkonvention, sondern gegen seine eigene revolutionäre Inszenierung von 1954 zu behaupten; eine Konstellation, die deutlich macht, wie sehr das neue Bayreuth schon in die Tradition des heutigen Musiktheaters hineingewachsen ist.
Der Gegensatz der beiden Inszenierungen ist auf eine einfache Formel zu bringen: ging es damals mehr um die Askese, so geht es jetzt mehr um den Eros. Nicht nur, daß die Szenen der Venus stärker akzentuiert sind. Das Ganze ist leuchtender, farbiger, weltlicher geworden. Herrschte damals ein starrer, karger – übrigens ungemein eindrucksvoller – Expressionismus in Bild und Aktion, so sieht man heute ein ruhigeres, distanziertes Spiel, eine weichere Harmonie von Farbe und Licht, einen schönen Luxus des Kostüms; ihm entspricht ein Aufwand an schönen Stimmen, der die Aufführung zum üppigen Konzert macht. Die Zeit der Abstraktion, der Entsinnlichung ist zu Ende; die bildende, erfindende Phantasie hat ihr Recht zurückerhalten.
Dabei ist Wieland Wagner keinen Schritt von seinem Prinzip des stilisierten Theaters abgegangen. Das zeigt schon der Anfang, die Szene im Venusberg, die die Sensation des Abends ist. Den choreographischen Teil bestreitet Maurice Béjart mit seinem Brüsseler Ballett; Venus ist eine dunkelhäutige Amerikanerin, Grace Bumbry, glaubhafte Verkörperung einer Göttin in Erscheinung und strahlendem, noch im Schrei edlem Stimmklang. Sie thront im Vordergrund, in gleißendem Brokatgewand und hohem Kopfputz, unbeweglich wie eine Statue; hinter ihr in dunklem, unbestimmbarem Raum der Tanz der Bacchanten, der (das Bacchanal der Pariser Fassung wird aufgeführt ) mit einem wilden, naturalistischen Schrei hereinbricht und sich sogleich zu kühler tänzerischer Artistik stilisiert. Eine Grotte senkt sich von oben herab, ein durchsichtiges Geäst, in das abstrakt-nackte Körper verflochten sind. Sie lösen sich heraus, mischen sich in die gezügelte, gezirkelte Orgie der anderen. Der Tanzstil des "Sacre" wird auf das romantische Musikdrama angewandt; die Wirkung liegt in der Diskrepanz der Elemente. Eine gewagte Konstruktion, ein Versuch, vielleicht nicht gelungen, nicht frei von Assoziationen an Revue und Akrobatik; aber doch die Bemühung, dem Thema "Eros", das Wagner mit schwelgerischer Unbedenklichkeit behandelte, mit modernen, distanzierenden Mitteln beizukommen.
Den Überraschungseffekt der Verwandlung läßt der Regisseur sich bewußt entgehen. Langsam, mit Sichtbarkeit des technischen Vorgangs, erscheint aus dem Dunkel der Unterwelt das Bühnenbild, ein leerer, nach hinten verjüngter Raum mit kulissenhaft gestuften Seitenwänden; im Hintergrund drei hochstämmige Bäume mit runden grünen Kronen; stilisiertes Theater, auch in der Aktion. Der Gesang der Pilger erklingt hinter der Szene, während Gruppen schwarzgekleideter, kreuztragender Büßer mit ekstatischen Gebärden stumm über die Bühne ziehen. Das Septett der Sänger ist eine oratorienhafte Gruppe, der Auftritt des Jagdtrosses mit Spießen, Bogen und reichlicher Beute ein heiteres Tableau in Grün.
Der Raum bleibt als Einheitsdekoration stehen, er ist Saal und, goldbraun beleuchtet, mit entlaubten Bäumen, herbstliches Schlußbild. Der Sängerkrieg wird zum farbensatten Schaustück, von dessen violettem Grundton sich das reine tiefe Blau Elisabeths und das Goldrot Tannhäusers, des Höllenritters, als leuchtende Kontraste abheben. Erst im dritten Akt triumphiert die szenische Askese. Der Venuszauber gefriert zum technisch exakten Ballett. Kein Trauerzug, kein Auftritt der Pilger mit dem grünenden Stabe der Vergebung, nur Gesang hinter der Szene. Tannhäuser und Wolfram allein auf der weiten Bühne; die Einsamkeit des Todes kann nicht erschütternder dargestellt werden.
Wolfgang Sawallisch, der Dirigent, musiziert klar und präzis, mit klanglicher Brillanz, in frischen, drängenden Zeitmaßen und in elastischem Kontakt mit den Sängern, aber ohne die Steigerung zu Rausch und tragischer Erschütterung, die die Essenz des Werkes sind. Erst im dritten Aufzug kommt aus dem Orchester nicht nur Klang, sondern auch die dramatische Leidenschaft, die den Gesang auf der Bühne erfüllt. Die Sängerbesetzung ist wahrhaft großes Bayreuth. Elisabeth, die lyrische Gegenspielerin jener stimmgewaltigen Venus, ist Victoria de los Angeles, bezaubernd durch Ausgeglichenheit und Kultur ihres edlen, samtweichen Soprans, ergreifend durch die Schlichtheit des Ausdrucks, die niemals den lauten Effekt sucht, sondern das Melos von innen durchglüht und noch im verhaltenen Piano die Bühne beherrscht. Sie zeigt, daß man Wagner "singen" kann. Das tut auch Dietrich Fischer-Dieskau, dessen Wolfram nun so fein nuanciert, so männlich groß und schwärmerisch zart, so frei von jeder falschen Sentimentalität ist, wie man die Partie kaum jemals vorher gehört haben dürfte. Wolfgang Windgassen hat stimmlichen Glanz, feuriges Temperament und scharfe Charakteristik, Josef Greindls Landgraf wächst von väterlicher Würde zur Strenge des Richters. Aus der Gruppe der Minnesänger treten der Walter Gerhard Stolzes und der Biterolf von Franz Crass als persönliche Gestalten hervor; bis zu dem Hirtenknaben Else-Margrete Gardellis ist alles kantabler Wohllaut, der Chor, von Wilhelm Pitz studiert, gibt mit Bußgesängen und Gnadenhymnen den gewaltig an- und abschwellenden Klanghintergrund.
Das Publikum des Eröffnungsabends applaudierte lange und enthusiastisch einer Aufführung, die bewies, daß der neue Bayreuther Stil zur Harmonie in sich hineingefunden hat, daß eine moderne, romantisch inspirierte Schönheit der theatralischen Vision geschaffen ist, daß der Gegensatz zwischen den künstlerischen Überzeugungen des neunzehnten und des zwanzigsten Jahrhunderts, der die ältere Generation erregte, sich der jüngeren zu schließen scheint.
Werner Oehlmann
Kölner Rundschau, 25. Juli 1961
Zweiter Versuch mit "Tannhäuser"
Wieland Wagners Bayreuther Festspielinszenierung überzeugte nur teilweise
Über Bayreuths Eröffnungspremiere hingen graue Wolken. Nicht nur am Himmel, sondern auch über dem "Tannhäuser". Kinder, schafft Neues – Richard Wagners fordernder Spruch verlangt seinen Tribut. Wieland Wagner ist jetzt, nach zehn Jahren Neu-Bayreuth, an dem Punkt angelangt, da er sich entweder wiederholen oder dazu zwingen muß, um jeden Preis zu ändern, umzustürzen, Neues zu bringen.
Seine erste Wiederholung ist dieser "Tannhäuser". Er hatte ihn vor sieben Jahren kühn und kämpferisch auf Bayreuths Riesenbühne gestellt, noch nicht ausgegoren, aber mutig in den Kontrasten zwischen Sexus und Eros, zwischen der verzehrenden Glut des heidnischen Venusberges und der unerbittlich strengen Ordnung des Christentums mittelalterlicher Prägung.
Béjarts Fehlzündung
Der Mut zu diesen Kontrasten hat den Wagnerenkel bis heute nicht verlassen. Für die Choreographie des Venusberg-Bacchanals griff er diesmal nicht auf die Mitarbeit seiner Frau zurück, sondern holte sich den mit zehntausend Volt geladenen französischen Ballettrevolutionär Maurice Béjart und seine neue Brüsseler Truppe nach Bayreuth. Zwischen dessen Glanznummer "Haut Voltage" (Hochspannung) und "Symphonie pour un homme seul" (Symphonie für einen einsamen Menschen) sollte sich vermutlich die Orgie im germanisch-mythischen Hörselberg abspielen, aber aus der geplanten Entladung wurde unglücklicherweise nur eine Fehlzündung mit hohlem Geknatter.
Wer die Schuld daran trägt, läßt sich schwer sagen. Wenn Richard Wagners Tristan-getränkte Pariser Fassung des Venusbergs im Orchester aufglüht, stürzt sich mit rauhem Brunstschrei eine Meute wilder Faune auf spitz und annährend klassisch tanzende Najaden, und es hebt allsogleich eine zappelige Gymnastik an, die fatalerweise so aussieht, als habe der komische Erzpantomime Jacques Tati einen grotesken Zeitrafferfilm über ein Sportfest der Freikörperkultur gedreht.
Anstatt daß dem Zuschauer der Atem stockt, beobachtet er nur ängstlich, ob es gar noch peinlicher wird. Und es wird peinlicher. Für einen Augenblick nimmt es einem zwar tatsächlich den Atem, wenn sich nämlich in das mythische Dunkel der Szene ein magisch leuchtendes Riesennetz senkt, in dessen gebauchtem Inneren man nach einigen Sekunden unschwer weitere Najaden und Nymphen entdeckt. Gespannt auf einen großen künstlerisch-magischen Wurf, erlebt der Zuschauer jedoch lediglich weitere Liebesgymnastik mit eilig hinaufhantelnden Faunen, die sich in derber Attitüde sehr eindeutigen, platten Riten hingeben.
Die schwarze Venus
Damit ist, das sollte man sehr entschieden feststellen, der Venusberg 1961 noch unter dem Niveau von 1954. Die einzige Faszination geht, sieht man von der Kraft der Musik ab, von der statuarisch thronenden, äthiopisch-heidnischen Venus aus, der die bronzefarbige amerikanische Negersängerin Grace Bumbry, von einigen deutschen Rassenwahnsinnigen mit Protestbriefen bedacht, sowohl die Kraft der hochdramatischen Stimme als auch die nötige persönliche Ausstrahlung zu geben wußte.
Denn selbst der Sänger des Tannhäuser, Wolfgang Windgassen, konnte seine bedeutende Position im ersten Akt nicht behaupten. Er sprang seine Partie zwar mit ungewohnter innerer Beteiligung und stimmlichem Nachdruck an, blieb jedoch bedenklich unter dem Ton und wirkte auf eine Weise forciert, daß man für die beiden folgenden Akte starke Befürchtungen hegen mußte.
Erstaunlich, daß dann der zweite Akt, der Sängerkrieg auf der Wartburg, trotzdem zu großer Form anlief. Hier hatte Wieland Wagner offenbar mit äußerster Konzentration gearbeitet und die 1954 noch stilisierte dramatische Aktion entfesselt und zu höchster Wirkung gesteigert. War der Pilgerzug im Wartburgbild des ersten Aktes noch ein schlechter Triumph des Unnatürlichen (Pulks von jeweils drei Büßern schoben sich von verzückt voraneilenden Einzelgängern überschnitten, stumm zu einem unsichtbar bleibenden Hintergrundchor gen Rom), so bemühte sich der Regisseur im zweiten Akt erfolgreich um eine intensive dramatische Belebung der Konflikte zwischen den sittenstrengen Sängern um Wolfram von Eschenbach und dem nach körperlicher Liebe schmachtenden Tannhäuser.
Im dritten Akt gibt es dann wieder ein paar heftige Schwächen, vor allem in der Erlösungsapotheose des Finales, die in ihrer elektrischen Heiligenscheingloriole jenes szenische Kunstgewerbe beschwört, das schon in Wieland Wagners "Lohengrin", aber auch in anderen Inszenierungen ärgerlich um sich gegriffen hat.
Am Pult stand an diesem zwiespältigen Abend Wolfgang Sawallisch. Was auf der Bühne nicht zu einhelliger Wirkung zusammenkommen wollte, geschah von einigen Schwankungen abgesehen, im wundervoll klingenden Orchester. Sawallischs bisher reifste Bayreuther Leistung bestand darin, daß er sich ganz in die Partitur versenkte und sie zu romantischem Blühen brachte. Vermißte man im Vorspiel und im ersten Auftakt noch ein wenig die schärferen Akzentuierungen, so stellte sich die kraftvollere Färbung in den beiden folgenden Akten dann doch noch ein, ohne daß die Feinheiten von Wagners Handschrift darunter zu leiden gehabt hätten. Vorbildlich auch das feinfühlige Begleiten der Sänger und der Verzicht auf jugendliche Geschwindmärsche – bis auf einen einzigen im großen Duett Tannhäuser-Elisabeth im zweiten Akt. Aber da mögen die Solisten auch ein wenig Schuld gehabt haben.
Das Ensemble
Wolfgang Windgassen in der Titelpartie wuchs nach dem schwächeren ersten Akt sehr imponierend in die Gestalt hinein und legte auch die störenden Intonationstrübungen fast ganz ab. So stark und verinnerlicht hat man den Sänger hier noch nicht gesehen. Nicht so glücklich erwies sich die Verpflichtung der spanischen Sopranistin Victoria de Los Angeles für die Rolle der Elisabeth. Rein stimmlich bot sie zeitweise schönsten lyrischen Liedgesang, aber ihr kleiner Wuchs und die übertrieben empfindsame Gebärde wirkten sich doch recht wenig überzeugend aus. Josef Greindl war ein klassischer Landgraf, Dietrich Fischer-Dieskau ein ungemein verinnerlichter Wolfram und Gerhard Stolze ein plastisch und schön singender Walther von der Vogelweide. Franz Crass (Biterolf), Theo Adam (Reinmar von Zweter), Georg Paskuda (Heinrich der Schreiber) und Else-Margrete Gardelli (Hirtenknabe) rundeten das Ensemble vorteilhaft ab. Unübertrefflich wieder die von Wilhelm Pitz einstudierten Chöre.
Zum Schluß gab es tosenden Beifall. Richard Wagners Musik triumphiert eben auch dann, wenn die Szene auf die puritanischste Weise entrümpelt ist.
Günter Bendig
Kölner Stadtanzeiger, 25. Juli 1961
Lust und Askese elementar
Bayreuther Festspiele: "Tannhäuser" in Wieland Wagners Meisterregie
Der "Tannhäuser" mit einer schwarzen Venus und dem Bacchanal in der Choreographie von Maurice Béjart: Wieland Wagner hat sich zur Feier der Vollendung des ersten Neu-Bayreuther Dezenniums etwas einfallen lassen, um sein internationales Publikum und vor allem dessen Intellektuellenschicht bei der Stange zu halten. Gegen den Auftritt einer Negersängerin als Venus protestierten zwar brieflich etliche treudeutsche "Wagner-Anhänger" noch vor der Premiere; ganz zu Unrecht indes, wie sich zeigte, und nur, um den anderen den Mut des kühnen Regisseurs desto deutlicher vor Augen zu führen. Viel eher ist über das Experiment mit Béjart zu streiten.
Eine "Variante" zu seiner "Tannhäuser"-Inszenierung von 1954/55, dem größten Wagnis dieser zehn Bayreuther Nachkriegsjahre, nennt der Wagner-Enkel allzu becheiden die neue Einrichtung des Werkes. Die Szene hat sich gegen damals grundlegend gewandelt. In vielem zu ihrem Vorteil. Wohl ist es wieder ein abstrakter, im Bühnenbild sogar entschieden vereinfachter, halbwegs oratorischer "Tannhäuser", der den gewohnten Vorstellungen von der Landschaft der Oper, von Hörselberg und Wartburgtal, von Wald und Ritterhalle radikal widerspricht. Das romantische Erlösungsethos hat Wieland Wagner vom penetranten Zeitgeist eines überlebten bürgerlichen Idealismus, wie ihn die männerchorfreudige Wartburgwelt vertritt, gründlich befreit. Gewaltiger aber und mit einer stilistischen Geschmeidigkeit ohnegleichen wird jetzt die dialektische Grundidee der Oper als Legende hervorgetrieben, die Antithese von elementarer Lust und höchster Askese. Tannhäuser steht in einem ungeheuren Spannungsfeld, dessen Pole eine bis zur Identität mit der von ihm angerufenen Gottesmutter erhobene Elisabeth und eine Liebesgöttin von archaisch-mythischer Größe sind.
In stickig-grauem Dunkel, aus dem ein amorphes Gebilde glitzert, halb Schaumfetzen, halb Plasma, thront auf hohem, weit zur Rampenmitte vorgezogenem Gestühl mit ausgebreiteten Armen unbeweglich diese Göttin: eine Venusstatue aus Ebenholz im starren, metallisch schimmernden Faltenwurf ihres Kleides. Das Bild, gleichsam ein Negativ des Maria-Elisabeth-Bildes, ist von großartiger archetypischer Kraft – ein meisterlicher Einfall, der die von Wagner nach seinem eigenen Eingeständnis vernachlässigte Rolle endlich hinreichend bedeutend macht. Und herrlich erfüllt die farbige Amerikanerin Grace Bumbry auch gesanglich die Partie mit dem warmen, volltönenden Klang ihres Mezzosoprans.
Das von Béjart mit einer Gruppe seines Brüsseler "Ballet du XXième Siècle" choreographierte Bacchanal (der Pariser Fassung) bietet dagegen kaum schon eine gültige Lösung dieser schwierigen Szene, von der übrigens Wagner selbst nur eine musikalische, keine szenische Vorstellung hatte. Was Wieland Wagner an Béjarts Inszenierung des "Sacre" von Strawinsky fasziniert hat und was nun in einzelnen "barbarischen" Elementen als ein Pandämonium nackter Geschlechtslust auch in "Tannhäuser" wiederkehrt, verfehlt das Irisierende, rauschhaft Gleitende der Musik, verfehlt es gerade durch seine tänzerische Artistik.
Gewagt bis an die Grenze
Freilich wird durch die kühle, ja pedantische Perfektion dieser modernen Venus-Mysterien-Gymnastik die äußerst gewagte, bis an die Grenze gehende Bewegungssymbolik überhaupt nur erträglich. Das gilt besonders von Béjarts vielleicht dem Bilde der "Schaumgeborenen" entstammendem, umständlich abwegigem Einfall, in barocker Manier vom Schnürboden ein nach unten sich öffnendes riesiges Fischernetz voll nackter Mädchenleiber herabzulassen, das alsbald die Jünglinge stürmen, um ihre Körper mit denen der Mädchen in "Deckung" zu bringen. Béjarts unmögliche Zutat ist der Ungebärdigen laut ausgestoßener Brunstschrei. Dennoch überragt das Bacchanal bei weitem das kümmerliche Tanzarrangement des dritten Aktes: auf der relativ hellen Bühne läuft der Tanz als Sonderballettvorführung unorganisch und störend neben dem musikdramatischen Ringen Wolframs mit Tannhäuser her.
Das stärkste Erlebnis dieser Aufführung ist Wieland Wagners geniale Personenführung, wie sie den Zug der Rompilger im ersten und dritten Akt, dieser packenden Regie einzelner, von der Bildkraft mittelalterlicher Miniaturen inspirierter kreuztragender Gruppen auszeichnet, wie sie im Sängerwettstreit auf der Wartburg ihren Höhepunkt findet. Die Szene ist fast entleert, ein geschlossener goldgrün leuchtender Raum, der das hohe Rechteck der Bühne betont, das Wartburgtal durch drei leicht nach Jugendstilart ornamentierte, später entlaubte Bäumchen, die "teure Halle" durch den Thron der Elisabeth in der Mitte und Bänke für die Edlen ringsum charakterisiert. Als fester Neu-Bayreuther Stilbestandteil kehrt die symmetrische, auf die Mittelachse bezogene Spielführung wieder, die am Schluß des ersten Aktes allerdings zu einer Wirkung von unfreiwilliger Komik führt, wenn aus den Seitenbehängen Reihe um Reihe die Jagdgesellschaft hervortritt, zeremoniös nach Trägern von Speeren, Hörnern und schließlich der Jagdstrecke geordnet.
Das Ausgezirkelte, Durchchoreographierte aller Schrittbewegungen, das feine, biegsame Gebärdenspiel gewinkelter Hände und Häupter, Erscheinungen wie der am Schluß im Hintergrund durchscheinende Fries von Engelsköpfen mit Gloriolen – das alles hat die kostbare Schönheit romanischer und gotischer Malereien – mag einem vor der perfektionistischen Ausführung auch manchmal angst und bange werden. Denn solche Preziosität in Farbe und Form birgt Gefahren. Erstaunlich aber bleibt, wie das meiste dennoch mit der dramatischen Aktion in Einklang gebracht ist, bis auf wenige Stellen, etwa wenn Wolfgang Windgassen, in der Titelpartie, dem anderen Extrem verfällt und in naturalistischem Verzweiflungsausbruch nur noch spricht.
Windgassen gibt im übrigen einen Tannhäuser von tiefer Menschlichkeit, oft von rebellischer Wucht. Ausgiebig seine Stimme (nach anfänglicher Nervosität und bei gelegentlich indifferenter Färbung), maßvoll gesteigert die Geste bis zur mächtigen mimisch-dramatischen Entladung in der Romerzählung. Mit ergreifender Seelenanmut verkörpert die in Bayreuth debütierende Sopranistin Victoria de Los Angeles die Elisabeth – eine Erscheinung von kindlicher Zartheit und wundervoller Gebärdensprache, stimmlich vor allem im Lyrischen berückend. Dietrich Fischer-Dieskau bleibt der ideale Vertreter der Wolfram-Partie; der Schmelz seines Baritons ist unversehrt, seine feine, beseelte Ausdruckskunst triumphiert im Lied an den Abendstern. Josef Greindl als würdiger Landgraf, unter den Wartburgsängern der prachtvolle Biterolf von Franz Crass und die Meisterchöre von Wilhelm Pitz runden das glänzende Festspielensemble dieser Aufführung.
Wolfgang Sawallisch ist ihr ingeniöser Dirigent. Er musiziert überraschend weich und ruhig, hält den Klang merklich zurück und macht ihn schlank und durchsichtig, ohne ihm etwas an Intensität zu nehmen. Bühne und Orchester tönen in vollkommener Ausgewogenheit zusammen, faszinierend die feine Leuchtkraft der schwirrenden Bacchanalmusik. Das illustre Publikum begeisterte sich in ungewöhnlichen Beifallsformen.
Friedrich Berger
Stuttgarter Zeitung, Datum unbekannt
Die Hölle der Venus
Wieland Wagners neue Bayreuther "Tannhäuser"-Inszenierung
Die Erinnerung an Hieronymus Bosch drängte sich auf: in einer grünen Dämmerung hing ein riesiges, halb zerbrochenes Ei aus geflochtenen Stricken, an die sich nackte, ineinander verkrampfte Leiber klammerten. Das Bacchanal im ersten Akt des "Tannhäuser" war in der Inszenierung Wieland Wagners und der Choreographie Maurice Béjarts ein Höllenbild. Doch wirkte die Nacktheit weniger obszön als unterweltlich; Fragmente von Ballettfiguren, die aus dem Gewimmel hervorstachen, stellten den Taumel als irren Zwang dar. Aus dem Paradies der Lust war die Lust vertrieben. Und in dem fahlen Licht des Berginnern sahen die Bacchanten, als sie während der Szene zwischen Venus und Tannhäuser bewegungslos am Boden lagen, wie Leichen aus. Die zum Idol versteinerte Göttin, die in Wieland Wagners Hörselberg thronte, war nicht Venus, sondern Hekate.
Das Gegenbild zum Anfang mit Hieronymus Bosch war der Schluß mit Fra Angelico. Daß der Trauerzug mit Elisabeths Sarg und die Pilger, die vom Wunder des grünenden Stabes berichten, nicht auftraten, daß also der Chor hinter die Szene verbannt wurde, kann man als Gedanken rechtfertigen: der Kondukt und der Pilgerzug bewirken nichts, sondern sie bedeuten nur etwas; sie sind – im Unterschied zu dem Pilgerzug, in dem Elisabeth vergeblich nach Tannhäuser sucht – keine Aktionen, die eine Reaktion herausfordern, sondern bloße Zeichen für Tannhäusers Erlösung. Das Sinnbild aber, durch das Wieland Wagner die fehlende Realität ersetzte, war ein Fehlgriff: der Chor von Engeln mit leuchtendem Heiligenschein, der am Himmel erschien, geriet in gefährliche Nähe zum Kunstgewerbe. Der Versuch, den jenseitigen Gehalt der Szene nicht vermittelt durch diesseitige Ereignisse, sondern unmittelbar allegorisch darzustellen, mag sinnvoll sein; aber noch ist er nicht geglückt.
Die Inszenierung demonstrierte weniger einen Stil als eine Manier – das Wort als Unterscheidung, nicht als Vorwurf verstanden. Wieland Wagner ist bis zur Blindheit gegenüber dem Text von der Tendenz besessen, die Aktionen zu lebenden Bildern erstarren zu lassen, die den Sinn der Szenen allegorisch ausdrücken sollen. Sogar beim Zug der Pilger war die Bewegung durch Wiederkehr des immer Gleichen aufgehoben: die Ähnlichkeit der einzelnen Gruppen, die im ersten Akt dunkel gekleidet und unter das Kreuz gebeugt nach Rom zogen und im dritten Akt in hellen Gewändern und mit erhobenem Kreuz zurückkehrten, war so peinlich genau, daß sich der Gedanke an Abziehbilder aufdrängte.
Gerade in einer Inszenierung, die versucht, den Hintergrund des Werkes zum szenischen Vordergrund zu machen, ihn nicht nur ahnen zu lassen, sondern abzubilden, müßte deutlich werden, daß sich zwischen Tannhäuser und Elisabeth ein Drama ereignet, zu dem die anderen keinen Zugang haben und das von ihnen in jedem Augenblick falsch ausgelegt wird. Es scheint nur, als sei der Tannhäuser, der Elisabeths Entsetzen erregt, ein anderer als der, den sie liebt. In Wahrheit ist Elisabeth nicht erst durch das Preislied auf Venus, sondern schon von Anfang an von Tannhäuser zu Tode getroffen wie Isolde von Tristan oder Senta vom Holländer. Auch Wagners Opern kennen, wie die Musikdramen, nur eine Liebe, die wie ein Schlag trifft und der Welt entrückt und an deren Ende der Tod als Lösung des Unlösbaren steht. Die Heiligkeit, in die Elisabeth sich rettet, ist nichts als ein Versuch, den Abgrund zu schließen, der sich vor und in ihr aufgetan hat.
Die Elisabeth in Wieland Wagners Inszenierung aber war, leuchtend blau vor goldenem Hintergrund, eine Allegorie der himmlischen Liebe mit einigen liebenswürdig irdischen Zügen. Die Absicht Victoria de Los Angeles’, sanfte Hoheit darzustellen, war unverkennbar. Die Geste etwa, mit der sie Wolframs Begleitung abwies und zugleich um Entschuldigung bat, wirkte trotz aller Stilisierung unmittelbar beredt. Schade, daß Victoria de Los Angeles am Schluß der Hallenarie von ihrem ebenso schönen wie in allen Künsten der Phrasierung erfahrenen lyrischen Sopran das von Wagner nicht vorgeschriebene, sondern nur zur Wahl gestellte hohe H gewaltsam erzwang. Der Zirkel, daß der Ton gesungen wird, weil das Publikum ihn erwartet, und daß es ihn erwartet, weil er, und sei es mit äußerster Anstrengung, immer gesungen wird, ist ein Stück Opernbarbarei.
Die "schwarze Venus" sollte nicht als Sensation, sondern als Entdeckung gelten. Grace Bumbrys Stimme hat die Färbung eines Alts, aber die Gewalt und den Umfang eines dramatischen Soprans. (Daß man den Text nicht verstand, war nicht schlimm: denn er hätte der götzenhaften Starre widersprochen, die der Venus von der Regie aufgezwungen wurde.)
Die künstlerische Redlichkeit, mit der sich Wolfgang Windgassen als Tannhäuser, unbekümmert um Einzelwirkungen, auch musikalisch den Absichten der Regie unterwarf, war bewunderungswürdig. So sang er im ersten Akt das Preislied auf Venus einerseits stockend, andererseits hastig: in einem Venusberg, der Tannhäuser als bedrängende Unterwelt erscheint, ist auch sein melodischer Impetus gelähmt. Erst im zweiten Akt, als Tannhäuser beim Sängerkrieg die Maske fallen läßt, behauptet sich die Melodik des Liedes im triumphalen Glanz.
Wolframs Lied an den Abendstern als Ausdruck der Situation fühlbar zu machen und es nicht als bloßen schönen Augenblick aus dem Zusammenhang herausfallen zu lassen, ist ähnlich schwierig, wie Sentenzen in Schillers Dramen so zu sprechen, daß sie nicht wie Zitate wirken, die aus dem Volksmund in den Text hineingeraten sind. Und es war ein Zeugnis hoher musikalischer Intelligenz, daß Dietrich Fischer-Dieskau das Unwahrscheinliche glückte: einerseits hielt er schon das Arioso, das dem Lied vorausgeht, auf der Höhe des Kantablen; andererseits ließ er sich von der sinnfälligen Melodik nicht einfach tragen, sondern durchdrang sie bis in geringfügige Einzelheiten mit dem Sinn des Textes. Es klingt einfach und fast wie eine Phrase, wenn man die Einheit von musikalischer und dramatischer Darstellung rühmt; doch läßt sich von dem verwickelten Zusammenwirken und Ineinandergreifen verschiedener Momente, aus dem sie bei Fischer-Dieskau hervorgeht, durch Worte kein Begriff vermitteln.
Der Dirigent, Wolfgang Sawallisch, teilte mit Wieland Wagner die Neigung zur gewaltsamen Abweichung vom Gewohnten. Am drastischsten zeigte sich die Absicht, aus der Musik alles Prunkende zu verbannen, beim Einzug der Gäste in die Wartburg: Sawallisch nahm das Tempo so rasch, daß der musikalische Rhythmus die Schritte des Chores durchkreuzte und die Wirkung festlichen Pomps aufgehoben wurde. Aller Glanz der heftig aufwirbelnden Venusmotive, alle Versunkenheit in die Holzbläsermotive, die um Elisabeth einen Schein von Heiligkeit legen, konnten nicht vergessen lassen, daß Sawallisch einen Grundzug der Musik, das ruhige, feste Vorwärtsschreiten, verfehlte oder unterdrückte. Man kann Wagner nicht retten, indem man ihn verleugnet.
Das Publikum applaudierte eine halbe Stunde lang.
Carl Dahlhaus
Neue Ruhr Zeitung, Essen, Datum unbekannt
Gymnastikstunde bei der Venus
Neue Wieland-Wagner-Rätsel bei der Bayreuther "Tannhäuser"-Premiere
Dem Tannhäuser kann eine kleine Schocktherapie gar nicht schaden, sagt man sich und war darob ganz froh, daß diesmal Wieland Wagner mit der Neuinszenierung "dran" war. Also der Phantasievollere der beiden Wagner-Enkel – auch derjenige, dem die Phantasie leichter durchgeht.
Er liefere immer wieder neuen Diskussionsstoff, und er habe den Mut zum "Unkonventionellen", sagt man zu Recht von Wieland Wagner. Gut: Das größte Verdienst von ihm und seinem Bruder Wolfgang war es, daß sie Bayreuth den Heiligenschein genommen haben. Aber wo ist nun der Superregisseur, der die von den experimentierfreudigen Brüdern entfesselten Ideen wieder zusammenbindet zu einem wirklich gültigen Wagner-Stil unserer in Geschmacksfragen so heikel gewordenen Zeit? Es gibt ihn nicht.
Bei seinem neuen "Tannhäuser" ist W. W. einmal mehr der Macht des Visuellen erlegen. Aus seinem optisch fast überzüchteten Kunstverstand entwickelt er Größe und Klarheit szenischer Konzeptionen wie überflüssige Mätzchen. Und da beginnt das Rätselraten: "Was hat er gedichtet, was hat er geträumt?" möchte man mit Hans Sachs fragen.
Wunderschöner Sängerkrieg
Also ein Gedicht war sein Sängerkrieg in der Wartburghalle, das Kernstück des "Tannhäusers". Ein hochgrundiges mittelalterliches Gemälde mag ihn angeregt haben zu einer hochaufragenden, klar gegliederten Halle, in deren güldener Pracht sich das Farben- und Saitenspiel angemessen entfalten kann. Bedachtsame Stilisierung gibt der Szene Würde und Andacht ohne allen Edelkitsch, synchron zur Musik entwickelt sich aus dem Fest die Tragödie.
Dabei sind ein paar Einzeldinge am Ziel vorbeigeschossen, ohne den Gesamteindruck arg zu stören: Das Auftreten der Sänger mit erhobenen Armen und der angedeutete Handkuß für den Landgrafen wirken doch etwas zu gezirkelt.
Verblüffend war das erste Auftreten der Elisabeth. War sie nicht viel zu weiblich, zu charmant, ja gar ein bißchen kokett? War dies nun Regieanweisung oder ein bißchen Lampenfieber des Festspielneulings Victoria de Los Angeles?
Soweit so gut also der Sängerkrieg. Was um alles in der Welt mag nun den Regisseur bestimmt haben, der Wartburglandschaft praktisch das gleiche Szenenbild zuzuordnen wie der Wartburghalle? Hier sind stilisiert Fenster aufgemalt, dort hängen im Hintergrund drei genormte Bäume, die sich dann bei der wichtigsten Szenerie zu gabelähnlichen Gebilden verwandeln. Das ist der ganze Unterschied! Daß die Pilger in kleinen Gruppen, schwere Kreuze schleppend, vorüberziehen (während der berühmte Chor hinter der Bühne gesungen wird) ist eine akzeptable Stilisierung des üblichen Chorgetrampels. Aber die Einzelgänger dazwischen, die in einer Art Tanzschritt mit erhobenen Händen vorübereilen und offenbar besonders schnell in Rom sein wollen – sie sind eine arge Geschmacksverirrung ohne erkennbares Motiv.
Für den Venusberg hat man Maurice Béjart und sein "Ballett des 20. Jahrhunderts" aus Brüssel engagiert. Das Ergebnis dieses Aufwandes war unbefriedigend: Trotz technischer Brillanz wurde die – zugegeben nahezu unlösbare – Aufgabe nicht bewältigt. Frau Holda, so schien es, hatte eine Gymnastikstunde angesetzt, um deren Ablauf sie sich klugerweise nicht kümmerte: Starr archaisch saß sie an der Rampe, Tannhäuser zu Füßen, während hinter ihrem Rücken unter heftigem Springen und Laufen "Bacchanal" stattfand.
Der Wasserfall war zu einem Protoplasmagerinnsel erstarrt, und ebenso wie die Salzsäule der Venus von grüngoldenem Licht übergossen. Als besonderer Clou schwebte ein Netz von hauteng und –farben angezogenen Mädchen vom Bühnenhimmel, in dessen Maschen sofort neue Gymnastik begann. Stilisierte Erotik? Sie gelang allenfalls bei der erstarrten Venus, und zwar deswegen, weil von deren Darstellerin – wie Wieland Wagner es sich gewünscht hatte – eine "elementare erotische Wirkung" ausging. Die Choreographie von Béjart hatte dazu noch den entscheidenden Fehler, daß sie nicht mit der Musik übereinstimmte: die Höhepunkte überlappten einander.
Hinreißend: Fischer-Dieskau
Statt dessen paßte der Stil von Wolfgang Sawallisch zu dem aufgeregten Venusberg-Betrieb. Damit wären wir bei der musikalischen Seite der Bayreuther Premiere: Der junge Kölner, Hamburger und Wiener Generalmusikdirektor, der sich mehr und mehr auch zum Hausdirigenten von Bayreuth entwickelt, brachte das Bacchanal äußerst schnell und grell, womit er die Möglichkeit weiterer Steigerungen aus der Hand gab. Wie er überhaupt, wo es nur eben anging, zu scharfen Tempi neigte: Aus dem Einzugs- wurde ein Eilzugchor, und die Hallenarie – sie soll an sich schnell genommen werden – akzentuierte Elisabeths Erwartungsfreude nun doch etwas zu sehr. Andererseits ist Sawallischs souveräne Beherrschung des Orchesters und des Sängerapparats unverkennbar; das zahlte sich besonders bei den großen Ensembles am Ende des ersten und zweiten Aktes aus – sie erklangen in vollendeter Schönheit. Ein großes Bravo dem Orchester und besonders seinen Holzbläsern. Der Chor sang wie üblich meisterhaft.
Unter den Sängern – "Blick’ ich umher in diesem Erdenkreise" – dominierte um zwei Klassen über den anderen Dietrich Fischer-Dieskau. Er ist etwas dramatischer geworden, hat aber noch immer sein berühmtes Piano. Mit der Fähigkeit des großen Liedgestalters, Schmelz und Lyrik zu verschenken, ohne dabei schnulzig zu werden, ist er als Wolfram von Eschenbach genau am richtigen Platz. An zweiter Stelle ist Grace Bumbry zu nennen – Gott sei Dank war sie gut, so daß die Protestbriefschreiber auf ihrer Rassen-Ideologie sitzenbleiben und keine künstlerischen Argumente in die Hand bekommen. Mit jugendfrischem pastosem Mezzo sang sie die heikle Venus-Partie, die großen Opernhäuser sollten sich nach einem Vertrag umschauen. Victoria de Los Angeles, die mit großen Erwartungen empfangene Spanierin auf dem Elisabeththron, war uneinheitlich, weil (wie ich glaube) nervös.
Ein letzter Blick auf die Bühne: Zum Schluß erscheinen weder Krummstab noch Sarg der Elisabeth, statt dessen wird die Rückwand der alten "Landschaftshalle" durchsichtig. Es erscheinen zum Chor der jungen Pilger viele Köpfe mit vielen kleinen Licht-Heiligenscheinen.
Meinten wir nicht, der Heiligenschein von Bayreuth wäre hinwegstilisiert?
Herbert Burg
Salzburger Nachrichten, Datum unbekannt
Pilgerfahrt ins Zeichenhafte
"Tannhäuser" in Bayreuth – Auftakt mit Wieland Wagners Neuinszenierung
[...]
Als am Schluß nach zehn Vorhängen die Solisten der Hauptpartien jeder noch einmal ins Licht gerückt wurden – die "schwarze Venus" zunächst: Miß Bumbry; die Spanierin Victoria de los Angeles als Elisabeth; dann der Tannhäuser Wolfgang Windgassen, der Wolfram Dietrich Fischer-Dieskau, der Landgraf Josef Greindl, der Biterolf Franz Crass – erschien der Eröffnungsabend unter dem Dirigenten Wolfgang Sawallisch auch im einzelnen vom großen Erfolg signiert.
[...]
Rühmen wir an der musikalischen Leitung und Ausführung ihr Bedeutendstes, so ist es, was Wolfgang Sawallisch betrifft, ein sehr zuverlässig genaues, schlankes und ausgefeiltes Musizieren, dem nichts Wesentliches abgeht, um ein immer klares Gelingen auf der Bühne wie im Orchester zu begünstigen. Der Wagner-Klang behält bei dem Dirigenten eher streng gefaßte Proportionen, wobei er durch eine Lockerheit im dynamischen Konzept und schön strukturierte Orchesterfiguren für eine manchmal spröde Färbung des Forte zu entschädigen weiß. Am reifsten vereinigten sich die Vorzüge solchen Musizierens im dritten Vorspiel, das sich uns wegen der ätherischen Fernen seines Pianos zum bleibenden Eindruck formte.
[...]
Die Sängerbesetzung von 1961 ist in mehrfacher Hinsicht interessant und in einigen ihrer Hauptstützen grandios zu nennen. Da gibt es vor allem zwei Bayreuther Debüts bei den Damen, die sich Respekt erwarten. Die von den distanzierten Ur-Wagnerianern im voraus verschmähte, bei der Premiere freundlich akklamierte "schwarze Venus" der sehr jungen Amerikanerin Grace Bumbry sang – von der Regie auf einen archaisierenden Götterthron reglos festgebannt – die Herrscherin der Liebe; ein metallisch heller, edel geschulter Sopran von dramatischer Durchschlagskraft in der Höhe, dem noch Vortragsfülle und Farbigkeit zuwachsen dürften, um gerade auch die glutvolle Mittellage dieser Partie mit wesentlicher Intensität zu bewältigen. Die Spanierin Victoria de los Angeles zeichnete in madonnenhafter Zartheit ein Frauenbild der Fürstin, das zu rühren vermochte. Im Gesang ist ihr feiner lyrischer Sopran mehr einer sensiblen Führung als der großen eindringlichen Gestaltung fähig, zu der noch souveränere Register gehörten. So zeichnete sich ihr Debüt als Elisabeth wohl durch klug eingesetzte, gewinnende Mittel aus, aber der letzte, entscheidende Höhepunkt der Gebetsarie kam deklamatorisch nicht zum Tragen.
Die Titelpartie konnte hier keinen berufeneren Interpreten finden als Bayreuths unentbehrlich getreuen Heldentenor Wolfgang Windgassen, so wie er heute in Ehren besteht: mit seiner absoluten Stilsicherheit, seinem ausstrahlenden Wissen als Sänger und Gestalter und seinem bedeutenden stimmlichen Vermögen, das er vollends vom zweiten Akt an wieder als kapitaler Faktor der Aufführung geltend machte. Ihm zur Seite der Wolfram von Eschenbach Dietrich Fischer-Dieskaus. Keine Erwartung, wie hoch sie dem Ereignis an seinen Gipfel vorausgeeilt war, blieb unerfüllt. Dieser große Sänger Wolfram, dessen Idealität heute wohl von keinem anderen mit solcher Personifikation durchdrungen wird, dessen Stärke ganz von innen kommt, und der das verborgene Leid wie das erhabene Credo der Liebe als ein Mensch den Menschen wahr macht, feierte einen Triumph, der seiner Gaben würdig war. Der Minnesang und die dramatische Leuchtkraft Fischer-Dieskaus, die auch durch szenische Geometrie nicht zu bannen ist, sind die Krone des Tannhäuser-Festspiels. Eine glückliche Wahl brachte zum erstenmal den jungen Londoner Bassisten Franz Crass als Biterolf ins Land, und man darf dieser prächtigen, kernig schönen Stimme gewiß einen Weg in Bayreuth voraussagen. Den Walther singt der bewährte Gerhard Stolze. Josef Greindls Landgraf ist als eine konstante Größe überzeugend wie eh und je dem edlen Kreise vorgesetzt.
Wie es um Konstanz und Dauer dieses neuen "Tannhäuser" auf dem Grünen Hügel bestellt sein wird, wissen die Götter. Wir können es nur raten: noch weiter jedenfalls über das lebendige Menschenwesen der Sünder und Heiligen hinaus führt auch hier kein Weg.
Max Kaindl-Hönig