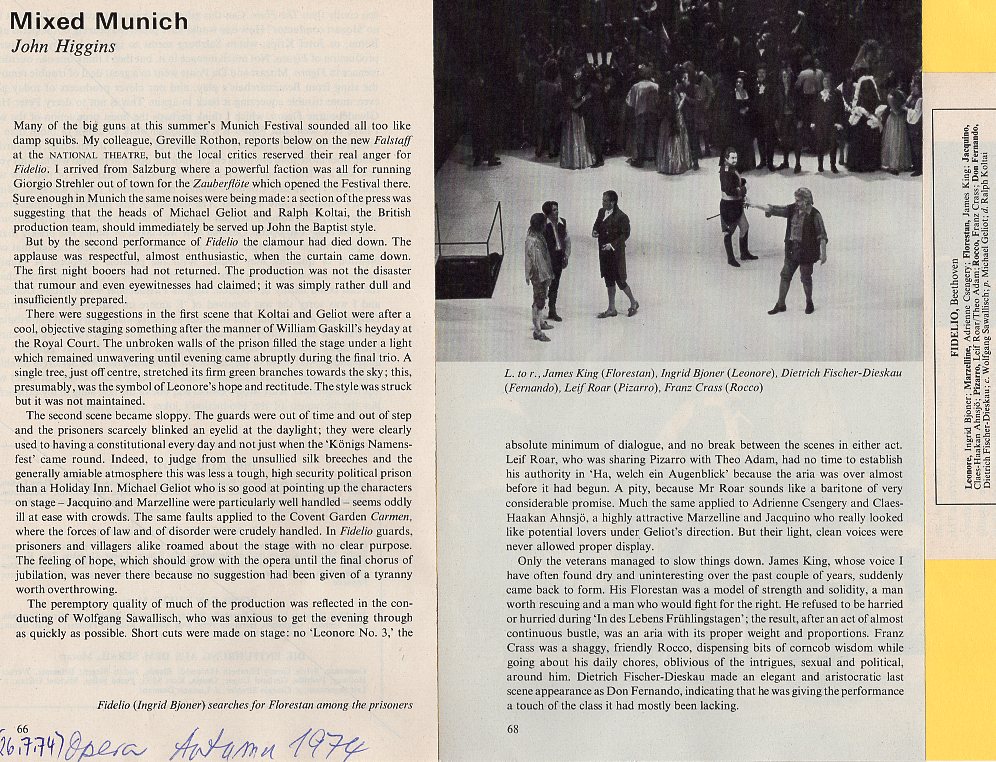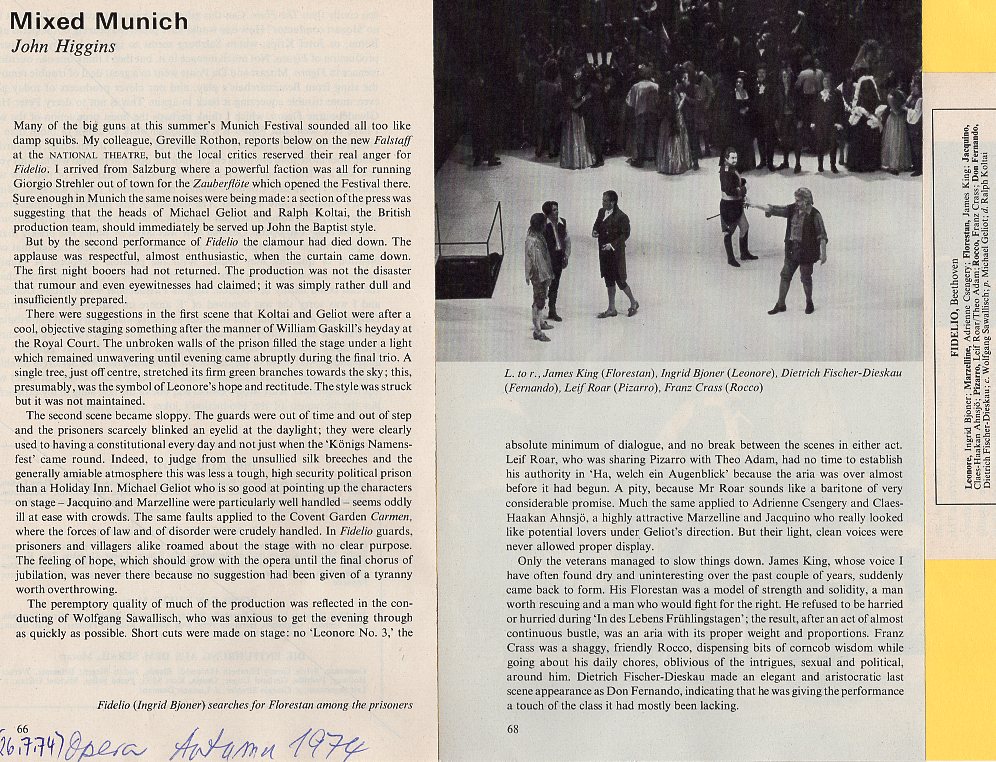
Zur Oper am 26. Juli 1974 in München
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Datum unbekannt
Dienst nach Befehl
Neuinszenierung des "Fidelio" bei den Münchner Festspielen
[...]
Dieser neu inszenierte "Fidelio" war matt, ungereimt, vom Inszenatorischen her mit vielen dilettantischen Zügen durchsetzt. Die Frage, die die Hauszeitung der Bayerischen Staatsoper an den jungen Leiter und Oberregisseur der Oper im englischen Cardiff, Michael Geliot, gerichtet hat, nämlich "Wie wurden Sie Opernregisseur?", wird manchen nach dieser Premiere weiterhin beschäftigt haben, gerade weil man weiß, daß Cardiff tatsächlich heute ein beachtliches und intensiv arbeitendes Opernzentrum ist.
Da war immerhin ein diskutables Konzept. Für den Regisseur ist der Gefängnisbeamte Rocco ein Mann, der wie Millionen andere seinen Dienst nach Befehl tut, als Beihelfer aller Tyrannei "fast" die Hauptfigur. Ralph Koltai unterstreicht die ewig aktuelle Tendenz im Bühnenbild: Das spanische Staatsgefängnis, terrassenartig angelegter Innenhof in ansprechender Betonbauweise, könnte auch der preisgekrönte Entwurf für einen Museums- oder Theaterbau unserer Tage sein. Darin nun spielt sich alles ab, biedermeierliches Bügeln, idealisches Leiden, Walten der Schicksale, humaner Appell und altvertrautes, opernhaftes Posieren, das Funktionieren von schönen, penetrant sinnvollen Maschinerien. Auch Gesang. Jeder für sich sein eigenes, gottlob zumeist bewährtes Format. Franz Crass als Rocco, mächtig, aus sich selbst entwickelt, löst die Konzeptfrage auf natürliche Weise: Sobald er singt, ist er ohnehin die Hauptfigur. Ingrid Bjoner, stark auf den letzten heroischen Aktus zuwachsend, singt die Leonore; James King die unterdrückte Flamme eines sehr jugendlich idealischen Florestan; Leif Roar einen geschmeidigen Pizarro, auch er von ausgesprochenem Festspielformat. Die junge Ungarin Adrienne Csengery singt ihre Marzelline naiv und frisch trotz der mitschwingenden Nervosität; einige lyrische Töne lassen aufhorchen. Einspringend für Claes Haakan Ahnsjö der Jacquino Willi Brokmeiers, hervortretend aus dem Gefangenenchor (Einstudierung Wolfgang Baumgart) Lorenz Fehenberger und Gerhard Auer.
Wer vor der Aufführung die Ankündigung Dietrich Fischer-Dieskaus in der Minutenpartie des Ministers für einen publikumsfreundlichen Trick der Direktion hielt, war nachher eines anderen belehrt. Kaum trat er auf, kehrte die ganze Oper zu sich selbst zurück, gewann Glanz in den sich steigernden Chorpartien, Würde und - so seltsam das klingen mag - Leichtigkeit, Grazie und zivilen Charme jenseits allen Verkündungspathos, bei dem das Publikum sonst so gern und pflichtschuldig viel Erhebung neben wenig Vergnügen verspürt. Endlich war auch das unter Wolfgang Sawallisch - für dessen weiteren Verbleib nach dem Ausscheiden des Intendanten Rennert sich ein Freundeskreis derzeit vehement engagiert - spielende Staatsorchester bei sich selbst angelangt, nachdem es sich fast einen Abend lang erstaunlich reserviert, unschlüssig und unkonzentriert verhalten hatte, "verunsichert" gewissermaßen, ob diese Inszenierung ihr Leonoren-Thema - das offensichtlich sehr alte Problem der Radikalen im öffentlichen Dienst - erhellend und dazu noch "festspielmäßig" würde abhandeln können.
Friedrich Hommel
__________________________________
Die Welt, Ausgabe H, Hamburg, 9. August 1974
Fixstern zwischen Salzburg und Bayreuth
Vor Rennerts Abgang und Everdings Antritt: Die Münchner Opernfestspiele
[...]
Auch den "Fidelio" prägt Fischer-Dieskau entscheidend. Sein später Auftritt als Minister gibt dem Abend eine selbstverständliche Größe, wie er sie zuvor nur dann gewinnt, wenn Theo Adam auf der Bühne steht: ein fester Pizarro von gefährlicher Gewichtigkeit - das teilt sich auch gesanglich mit -, kein schäbiger kleiner Schuft. Die Besetzung allgemein mit Kings Florestan, dem Rocco von Crass, Ahnsjös Jaquino nähert sich dem Optimum eines heutigen "Fidelio"-Ensembles, wenngleich Ingrid Bjoner mehr als eine solide Durchführung der Titelpartie kaum abliefert. Den Regisseur Michael Geliot hat man sich aus Cardiff verschrieben, eine kühne Wahl, die der Aufführung manchen Bruch einträgt, zwischen geschäftig-realistischem Herumgewerke und symbolträchtiger Starre, auch in den Bühnenbildern von Ralph Koltai, die einen streng kubistischen Spielraum mit handgreiflichen Requisiten wie Baum und Wäscheleine verunstalten. Immerhin, der Übergang ins Finaltableau gelingt, bei Verzicht auf Leonore III, geradezu überrumpelnd: Wie die pechschwarze Kerkergruft verschwindet, die Bühne zum freien Raum wird und sich immer mehr mit Licht füllt, während die Menschen von allen Seiten hervorstürzen, das läßt sich anschauen, ließe sich besser noch anschauen, wenn nicht die Kostüme wären, die aussehen, als spielte man eine "Carmen" im Directoire.
[...]
Peter Dannenberg
__________________________________
Süddeutsche Zeitung, Datum unbekannt
Fidelio oder Der verkleinerte Beethoven
Nachdem Leonores todesmutiger Handstreich das Drama entschieden hat, naht als verzögerter Deus ex machina der Minister und erhebt die einzelgängerische Tat ins Allgemeine. Nachdem die Festspiel-Neuinszenierung des "Fidelio" bereits zum mittleren Debakel geworden war, erschien im Kostüm des besagten Ministers Dietrich Fischer-Dieskau, und der fast beendete, fast besiegelte Abend nahm eine unverhoffte Wendung ins Überlebensgroße, also in Beethovensche Dimensionen. Daß es noch zu vielen Vorhängen und viel Jubel gekommen ist, nachdem vor der Pause das Stimmungsbarometer auf Tief gezeigt hatte, bewirkte der einzige, der bei dieser Premiere vollends in wie über seiner Rolle zu stehen vermochte. Wohin Fischer-Dieskau tritt, ereignet sich Kunst, und sträubten sich die Bühnenbretter noch so abstrakt. Sein Minister, ein edler, doch entschlossener Zivilist, trat in die spanisch bevölkerte Leere des Schlußbilds, und das bereits entschiedene Drama begann überhaupt erst. Man konnte sogar erkennen, wohin der englische Regisseur Michael Geliot hatte steuern wollen: in Richtung auf den eine mitwisserische, mitschuldige Mitwelt mitreißenden, "erlösenden" Einzelfall Leonore.
Schlechter Stern, gute Chancen
Geliot und der Bühnenbildner Ralph Koltai gingen hart angeschlagen aus der Premiere hervor. Schon die letzten Probentage sollen ihnen zugesetzt haben. Beide besaßen das in Sachen Kunst Unzulänglichste: den guten Willen. Streckenweise und zuweilen schrullig - aufwindbare Gitterroste über den Gefängniskellern - drangen sie sogar zum Kern des Werkes vor. Doch vorwiegend stand Ungereimtes nebeneinander: Realismus und Abstraktion, Sinnbild und Krimskrams, Psychologie und Konvention, historisches Kostüm und Betonflächen, Raum und ungestalte Leere, Geometrie und Bügeleisen, Überlegung und Ungeschick. Das Drama drängte ahnungsvoll ins Menschheitliche und verfing sich im Kleinen, so in Roccos Dialogsatz an den mit wohlfeil eingekauften Ketten zurückkehrenden Fidelio: "Die Rechnung, bitte!" Selbst wenn Beethoven diesen Satz geschrieben hätte, dürfte er ihn nicht geschrieben haben. Daß niemand lachte, lag an der einschüchternden Erscheinung des Franz Crass: ein stämmiger, volltönender, gar nicht seniler Kerkermeister, halb getreuer Eckart und halb Sheriff, der verläßliche Bulle, der unter jedem Regime seinen Fachmann steht. Crass trug den ersten Akt, im Verein mit Adrienne Csengery, die als jugendlich-lyrische Sopranistin von erstaunlicher Wendigkeit die Marzelline weit über soubrettenhaftes Gehabe hinaus profilierte und selbst bei ausgiebiger Beschäftigung mit idyllischen Requisiten (Bügeleisen usw.) nicht ins Neckische ausgleiten ließ.
Die Namen Crass und Csengery belegen bereits, daß mit Sängerpersönlichkeiten nicht gegeizt worden war, ja daß der Besetzungszettel ein Münchner Optimum versprach. Wieso eine halbgare, zähe und herzlose Vorstellung herauskam, warum Beethoven zum Gruselautor verkleinert wurde und weshalb die Idee dieses Menschenweihefestspiels nur schemenhaft umging, bleibt letzten Endes unerfindlich, selbst wenn man die Unzulänglichkeiten der Szene für hauptschuldig befindet. Der Abend war verhext; selbst Überragendes wie James Kings jugendlich-heldische Tenorpracht stand isoliert und beziehungslos in einem Niemandsland aus Leere und Betulichkeit. Ingrid Bjoner, eine wohlrenommierte und dramatischen Feuers fähige Leonore, blieb doloros und ohne rechte Initiative, so markig auch die Hörner des Staatsorchesters ihre kühne Entschlossenheit unterstrichen. Die gefürchtete Arie gelang routiniert und beiläufig. Erst die Nähe Florestans brachte Leben und Farbe in die Stimme. Leif Roar (Pizarro) gab den üblichen Brunnenvergifter in französischer Offiziersuniform; statt des Grauens brachte er eine elegante Figur und eine in der Höhe sattelfeste, beinahe schon heldische Baritonstimme mit. Willi Brokmeier war als Jacquino eingesprungen und bewies sportliche Kondition, indem er beim fortwährenden Durchhasten des Bühnenraums nicht außer Stimmkraft kam. Aus dem trefflich intonierenden Chor der heillos überschminkten, zu schier grotesken Elendstypen gestempelten Gefangenen (Einstudierung: Wolfgang Baumgart) lösten sich die akkuraten Soli von Lorenz Fehenberger und Gerhard Auer.
Divergenzen der Akustik, bedrohter Kontakt zur Bühne und allgemeiner Fatalismus hinderten Wolfgang Sawallisch, sein Konzept eines schlanken, durchsichtigen, sich parallel zur Handlung steigernden "Fidelio"-Klanges vollends in die Tat umzusetzen. Der unglückliche Abend verurteilte ihn des öfteren dazu, im Schlagtechnischen aufzugehen, um zumindest dem Buchstaben der Partitur gerecht zu werden, wenn sich schon der Geist des Werkes nicht herbeizwingen ließ. Künftige Vorstellungen werden vermutlich erweisen, daß Sawallisch einen Steigerungsbogen vom Singspielbeginn zum oratorienhaften Finale anstrebt und neben raschen Tempi auch des Nachdrucks fähig ist. Die 3. Leonoren-Ouvertüre opferte er auf dem in diesem Falle wackeligen Altar der fortschreitenden Handlung. Schade, denn bei geschlossenem Vorhang würde ihn nichts mehr vom eigentlichen Musizieren abgehalten haben.
Für die Unsicherheit der Inszenatoren ein aufschlußreiches Beispiel: Erster Akt. Umlaufende Mauern in zwei Etagen. Hellgrauer Beton. Unser an architektonische Monstren der Kahlheit gewohntes Auge mutmaßt die jüngste bayerische Landesuniversität oder das neue Patentamt, keinesfalls eine Anstalt für den bekanntlich humanisierten Strafvollzug. Dies wissen auch die Szenengewaltigen. So wird denn ein eben Inhaftierter von zwei rüden Soldaten hereingeführt. Drei Statisten müssen erst den Schauplatz definieren. Ein Himmelfahrtskommando der szenischen Evidenz. Nebenan ein hoher Baum und darunter ein kleinbürgerliches Idyll aus Bügeltisch, Bank und Wäscheleine. Sinnbild des vielberufenen Lebens, das weitergeht, und wenn die Welt voll Teufel ist. Der Vorgarten wird abgeräumt und weggetragen, sobald der Tyrann naht. Klägliches Ende eines Symbols.
Das zog sich hin bis gegen zehn. Dann erschien Dietrich Fischer-Dieskau. Und alles zeigte plötzlich ein anderes Gesicht.
Karl Schumann
__________________________________
Kurier, Wien, 3. August 1974
Am besten das Buffet
Total mißglückter Festspiel - "Fidelio" unter Michael Geliot und Wolfgang Sawallisch
Ganz vertan sind Opernabende in München nie, denn zur Not, wenn alles schief geht, kann man sich am Buffet schadlos halten. Die "Flambierten Himbeeren mit Vanilleeis" haben Festspielqualität.
Von den Aufführungen selbst läßt sich das, wie unlängst am neuen "Falstaff" dargelegt, nicht immer sagen. Doch sogar dieser hemdsärmelige, aller Serenität entbehrende "Falstaff" nimmt sich im Vergleich mit dem neuen "Fidelio" fast aus wie eine Modellinterpretation. Michael Geliot (Regie), Ralph Koltai (Ausstattung) und Wolfgang Sawallisch (Dirigent) verantworteten gemeinsam ein so großes Debakel, daß man alle jene insgeheim beneidete, die vor dem Theater vergeblich das Schildchen "Karte gesucht" in die Höhe gereckt hatten.
Im Grunde scheiterte Geliot, in seiner Heimat als Chef der Oper in Cardiff hoch geschätzt, in diesem "Fidelio" auf ähnliche Weise wie Strehler in der Salzburger "Zauberflöte", allerdings auf einem um etliche Stufen tieferen Niveau. Beide Stücke, und das hat niemand klüger dargelegt als Harald Kaufman, sind darin typisch österreichisch, daß so konträre Wesensmerkmale wie das Zaubermärchen und der Initiationsritus das naive Singspiel und die dramatische Chorsymphonie unverbunden nebeneinander stehen.
Beethovens "Karl"
Die Zahl derer, die sich an diesem Nebeneinander, an dieser friedlichen Koexistenz der dramaturgischen Mittel, gerieben, das vermeintliche Niveaugefälle beklagt haben, ist längst unübersehbar. Aber alle Versuche, den Schaden zu reparieren, laufen Gefahr, die innere Balance zu stören, der einen oder der anderen Welt nicht gerecht zu werden.
Ralph Koltai stellte als Gefängnis einen riesigen Betonklotz auf die Bühne, eine Art Orwellschen Atombunker, kahl, unmenschlich, vollmechanisch. Warum auch nicht? Aber spätestens mit Marzellines Griff zum Bügeleisen wird die Sache komisch, der Bruch spürbar, und Michael Geliot unterstreicht das bald danach durch eine historisch kostümierte Wachmannschaft.
Überhaupt diese Wachsoldaten ... In München sind sie ein abgerissener, völlig ungeordneter Haufen, den der leiseste Versuch einer Revolte hinwegbliese. Gut, ließe sich sagen, das beweist nichts als einen Mangel an inszenatorischem Professionalismus. Aber beweist es nicht doch mehr? Wie jeder Regisseur von einiger Ambition, so wartete nämlich auch Geliot mit der (sehr plausiblen) Erklärung auf, es wären niemals die Bösewichte selbst, sondern deren gefügige, gehorsame Mitläufer, die den Erfolg der Tyrannei möglich machen, allen voran Rocco, Beethovens "Herr Karl". Dienst ist Dienst, Befehl Befehl.
Geliot führt seine Idee ad absurdum, denn die Welt seines "Fidelio" ist nicht ermöglicht sondern gefährdet durch die Mitläufer: Soldaten, die kein Gewehr zu halten vermögen, sind keine Basis für einen Polizeistaat. Das gut Gemeinte schlägt um ins Ridiküle.
Lieblos musiziert
Komplett macht das Unglück allerdings erst Wolfgang Sawallisch. Kaum jemals zuvor habe ich ihn so kläglich, so derb, so lieblos musizieren gehört. Kein Wunder, daß Begabungen (Adrienne Csengery), Spitzenleute (James King), und Mittelmäßigkeiten (Franz Crass, Ingrid Bjoner, Leif Roar) gleichermaßen scheiterten. Ein Lichtblick: Dietrich Fischer-Dieskau. Sawallisch sollte in sich gehen. Es wäre schade, einen so qualifizierten Mann abgleiten zu sehen ins Mediokre.
Gerhard Brunner
__________________________________
Neue Zürcher Zeitung, 6. August 1974
Münchner Opernfestspiele
Mißglückter "Fidelio" - Bejubelte Rossini-Messe
Mit einer Neuinszenierung von Beethovens "Fidelio" sank das seit der Eröffnung mit Verdis "Falstaff" durch mehr oder weniger glanzvoll aufpolierte Reprisen […] im ganzen auf beträchtlicher Höhe gehaltene Niveau der Münchner Opernfestspiele 1974 merklich ab . Wer immer von der Intendanz der Bayerishen Staatsoper auf den Gedanken gekommen ist, für diese Inszenierung den englischen Regisseur und Operndirektor der Hafenstadt Cardiff, Michael Geliot, nach München zu holen - er hat damit den Festspielen keinen Gewinn zugebracht. Geliot und sein Landsmann Ralph Koltai, von dem die Bühnenbilder stammten, wurden am Schluß mit wahren Protestchören ausgebuht, und auch der Dirigent Wolfgang Sawallisch empfing in dieser Umgebung, gemessen an den sonst für den Generalmusikdirektor üblichen Beifallskundgebungen, nur gedämpfte Zustimmung. Es ging, bei erkennbarer Absicht, die große Steigerung vom Singspielidyll über das heroische Drama zum hymnischen Oratorienfinale herzustellen, vom Pult so etwas wie Resignation aus, als sei angesichts dessen, was die Bühne bot, nicht mehr zu erreichen gewesen, als die beiden Akte musikalisch achtbar, den Noten entsprechend (und eher elastisch-schlank als schwerfällig) über die Runden zu bringen. Von den Hinter- und Abgründen der Partitur, etwa in dem bös-schneidigen Marsch vor dem Auftritt Pizarros oder in der großartig schaurigen Orchestereinleitung zum zweiten Akt, war ebensowenig zu spüren wie von ihren exzessiven Aufschwüngen in der großen Leonoren-Arie oder im Duett "O namenlose Freude" - das war allenfalls Exaltiertheit, aber kein Befreiungsjubel und Wiederfindensüberschwang.
Auf der Szene herrschte eine Mischung aus verstaubtem Realismus mit Genrebildchen (Marzelline am Bügeltisch, die Jammergestalten der aus ihren unterirdischen Kerkern kriechenden Gefangenen) und einfallslosen Gruppenarrangements (Finale mit plötzlich à la Goya aufgeputzten Chormassen) in einem Viereck von Betonmauern, das ebensogut der Ladehof irgendeines modernen Supermarktes wie (so bemerkte ein boshaft-witziger Münchner Kritiker) ein Ausblick auf die jüngste bayerische Landesuniversität hätte sein können. Kläglich der Aufmarsch der Pizarro-Leibwache - er sah eher wie ein Appell des Krähwinkler Landsturms aus -, ohne jeden Schauer und Todeshauch das Verlies des gefangenen Florestan. Kein Wunder, daß bei so minimaler atmosphärischer Suggestion James Kings Klagen genau wie seine Freiheitsvisionen nicht die geringste Emotion spüren ließen; ein von seinem Schicksal und dessen Wende gleichermaßen unberührtes Opfer verbrecherischer Willkür hat es auf der deutschen Opernbühne lange nicht mehr gegeben. Für ihn sich zu kühner Tat und großem Gesangspathos zu entflammen mag denn auch der Leonore Ingrid Bjoners schwergefallen sein; so gut ihr manches an Emphase gelang, sie schien eher im Schmerz über das Los des Gatten befangen zu bleiben als zu ungemeiner Aktion entschlossen. Leif Roar lieferte als Pizarro einen gesanglich versierten Schurken vom Dienst ab, mit der kalten Bestialität eines zum gewissenlosen Mörder abgesunkenen politischen Desperados hielt er bis zur Konturlosigkeit diskret zurück. Von der Budapester Oper war Adrienne Csengery für die Marzelline gekommen, jugendlich-lyrisch, stimm- und bildschön, ohne Soubrettenneckischkeit. Ihr Vater Rocco erhielt von Franz Crass Profil - ein treuer Diener, welcher Staatsordnung auch immer, im Herzen ein Spießbürger, in Erscheinung und Stimmkraft mitnichten "bald des Grabes Beute".
Auf die Höhe beethovenschen ethischen Gedankenflugs wurde die sich über ihre szenischen Hemmnisse mühsam hinquälende Aufführung erst mit Dietrich Fischer-Dieskaus Auftritt als Minister Don Fernando gehoben - das war kein Deus ex machina, sondern ein Botschafter echter Humanität; Adel, Würde und Wärme waren seine Insignien, Zuversicht, ja Gewißheit lag in seiner Verkündigung vom Sieg der Brüderlichkeit.
[...]
K. H. Ruppel
__________________________________
Abendzeitung, München, Datum unbekannt
Applaus und Buhs nach der Premiere von Beethovens "Fidelio"
Gefangene am Bahnsteig
Nichts Neues an der Neuinszenierung der Oper "Fidelio" von Beethoven am Münchner Nationaltheater. Die zurückhaltende Reaktion des Publikums hielt bis zum Jubel des Schlußchores an, brach dann aber in Ovationen für die Sänger aus, die fast eine viertel Stunde dauerten. Gemeint sein durften: Dietrich Fischer-Dieskau, Franz Crass und James King. Saftiges Buh dagegen für den Regisseur Michael Geliot und Bühnenbildner Ralph Koltai, wovon ein Teil auch den Dirigenten Wolfgang Sawallisch traf.
Zwei Stunden langweilige bis triviale Inszenierung, ohne nachvollziehbares Konzept. Eine Großputz-Regie mit mühseligen Blankmacher-Versuchen, Hoffnungslosigkeit, Schauer und Trostlosigkeit szenisch darzustellen. Auf platt-naiven Symbolismus geschrumpft, zwischen torsohaften Kulissen und bedeutungslosen Gesten spielte sich etwas ab, wonach sich die Frage stellte: Warum diese Neuinszenierung?
Geliots "Fidelio" wirkte wie erste Regieschritte und hinterließ eine provinzielle, bereits bei der Premiere neueinstudierungsbedürftige Oper. Das Nationaltheater erbt mit diesem "Fidelio" für sein Repertoire ein Opus aus der Abstellkammer. Alle Vorurteile, die man gegen die Oper haben kann, wurden mit dieser Aufführung bestätigt. Statisch, ratlos, schauspielerisch ungelöst und auch lachhaft: Wenn Gefangene aus dem Kerker herauftaumeln und wie auf einem Bahnsteig herumstehen, oder wenn ein buntes Sonntagsvolk gleich Zinnsoldaten im letzten Leerbild auf weißem Boden und vor weißem Hintergrund strotzt.
Aus dem "Fidelio" wurde zwar kein Gefängnis, aber ein Käfig, in dem die Stimmen welkten: Ingrid Bjoner (Leonore) kämpfte mit deutlich spürbaren Rollen- und Stimmproblemen, "sang- und klanglos" agierten Leif Roar (Pizarro) und Willi Brokmeier (Jacquino). Nach der Pause besserte sich das Stimmgebilde etwas.
Auch Wolfgang Sawallisch dirigierte Beethoven belanglos wie ein Promenadenkonzert. Er steigerte sich lediglich am Schluß in der großen Freudenode "Wer ein holdes Weib errungen".
Das Niveau retteten James King als stimmlich überzeugender Florestan und Franz Crass als prachtvoller Rocco. Er war der einzige, der seine Rolle auch schauspielerisch belebte. Mit großer Stimme beeindruckte Adrienne Csengery, die ihre namhafte Konkurrenz buchstäblich in Grund und Boden "zu bügeln" versuchte. Sie verfügt über eine Naturstimme, die man noch schleifen müßte. Für Begeisterung sorgte Dietrich Fischer-Dieskau, schon bei seinem Erscheinen gab es keinen Zweifel, daß Ovationen nicht ausbleiben würden.
Thomas Veszelits
__________________________________
Badische Zeitung, Freiburg i.Br., 2. August 1974
Münchner Festspiele
Luftballons und gute Lehren
[...]
Belangloser "Fidelio"
Als zweite Premiere der Münchner Festspiele (die erste war, wie berichtet, Verdis "Falstaff") war [...] "Fidelio" erschienen. Bei dessen Besichtigung hatte man den ganzen Abend Zeit, sich zu fragen, was einen so "Fidelio"-kundigen Intendanten wie Günther Rennert wohl auf die Idee gebracht hat, dem englischen Regisseur Michael Geliot zu seinem Deutschland-Debut zu verhelfen. Nicht, daß der nennenswert viel falsch gemacht hätte - indessen: nichts, aber auch gar nichts in seiner Inszenierung und dem absolut belanglosen Bühnenbild Ralph Koltais, das einen Unbefangenen darauf brächte, das Stück sei irgendwie wichtig, habe eine Botschaft über die (sofort vordergründig, ja dilettantisch wirkende) Handlung hinaus.
Was Wunder, daß auch Wolfgang Sawallischs Beethoven-Interpretation über weite Strecken im Routiniert-Beiläufigen verharrte, bis ihr im zweiten Akt Dringlichkeit, Atemlosigkeit zuwächst. Genauer: vom ersten Ton an, den der hinreißend expressive Florestan James Kings singt. Immerhin: auch um ihn herum einiges Gute, vor allem von Ingrid Bjoners Leonore, von Leif Roars Pizarro, Franz Crass’ Rocco und von einem Minister, der wirklich eine singende Persönlichkeit ist: Dietrich Fischer-Dieskau. Dennoch: zu häufig drängt sich an diesem Abend im Nationaltheater der Eindruck auf, daß die Produktionsmaschinerie namens Staatsoper wieder mal einen Abend abgeleistet hat. Zu fürstlichen Preisen, versteht sich.
Heinz W. Koch
__________________________________
Badische Neueste Nachrichten, Karlsruhe, 31. Juli 1974
Mit "Fidelio" nicht fertiggeworden
Eine mißlungene Neuinszenierung zu den Münchner Opernfestspielen
Sagen wir es gleich: die zweite Neuinszenierung der Münchner Festspiele, Beethovens "Fidelio", war, nicht was die musikalische Wiedergabe, wohl aber was die Inszenierung anlangte, eine Enttäuschung. Die Bühnenbilder von Ralph Koltai zeigten im ersten Aufzug lediglich einen kahlen, wie eine Festung umschlossenen Gefängnishof, in dem ein schmächtiger blühender Baum das einzige "Lebewesen" darstellte. Die Gefangenen entstiegen zum Gruß an das warme Sonnenlicht Versenkungsluken und zogen sich wieder durch diese zurück. Im zweiten Akt wird das Kerkergewölbe, darin Florestan schmachtet, im allgemeinen nur angedeutet; das Schlußbild spielt, sonnenhell angestrahlt, auf podestartig leerer Bühne. Der englische Regisseur Michael Geliot hatte die umfangreichen Dialoge zwar wesentlich gekürzt, indessen nicht so gestrafft, daß sie wirksam in den dramatischen Bestand des Ganzen eingingen. In der Personenführung arbeitete er im allgemeinen mit konventionellen Mitteln; seine Grundidee, ein Bild menschlicher Unfreiheit und Befreiungshoffnung zu entwerfen, konnte er kaum plausibel machen.
Dabei hatte ihm eine sängerisch hervorragende Besetzung zur Verfügung gestanden. Ingrid Bjoner war eine der heroinenhaften Pose radikal entsagende, das Weibliche nie verleugnende, zuweilen mehr rührend als erschütternd wirkende Leonore und zeigte sich den stimmlichen Anforderungen der Partie vollauf gewachsen. Ein zum mindesten gesanglich ebenbürtiger Partner stand ihr im Florestan James Kings zur Seite. Den Pizarro verzerrte Leif Roar nicht zum Theaterbösewicht; stimmlich setzte er machtvoll ausholende Akzente, legte zugleich aber auch in sein Piano etwas vom Beklemmenden seines Wesens. Eine Leistung aus einem Guß, schlechthin vollkommen war der Rocco von Franz Crass. Seine Tochter Marzelline lag bei der mit jugendlich frischer, raumgreifender Stimme aufwartenden Adrienne Csengery in besten Händen. Den Jacquino gab Willi Brokmeier mit sympathischer Zurückhaltung. Erlesen schön sang Lorenz Fehenberger das Tenorsolo des Gefangenenchors. Die kleine, aber gewichtige Rolle des Ministers einem Künstler vom Range Dietrich Fischer-Dieskaus anzuvertrauen, erwies sich als fruchtbringender Gedanke. Am Dirigentenpult saß, vor allem im zweiten Akt impulsgeladene Höhepunkte ausformend, Wolfgang Sawallisch. Den Sängern wurde verdient stürmischer Beifall gespendet, während den Inszenatoren Buhchöre entgegenschallten.
Wilhelm Zentner
__________________________________
Nürnberger Nachrichten, 30. Juli 1974
Realistische Kleinmalerei
Konzeptionslose Neuinszenierung des "Fidelio" bei den Münchner Opernfestspielen
"Sawallisch muß bleiben", hieß es auf einem Flugblatt, das den Besuchern der zweiten Festspielpremiere im Münchner Nationaltheater in die Hand gedrückt wurde: das Staatsorchester macht sich Sorge um seinen Generalmusikdirektor, dessen 1976 auslaufender Vertrag noch nicht verlängert wurde, weil die von Sawallisch geforderten erweiterten Kompetenzen das Problem der Intendantennachfolge zusätzlich belasten. Als wolle Wolfgang Sawallisch beweisen, daß er bleiben muß, streifte er bei diesem optisch leider mißlungenen Festspiel-"Fidelio" die Kapellmeisterroutine ab und dirigierte mit einer Glut der Empfindung, die man an ihm in letzter Zeit so häufig vermißte.
Das Finale läßt Regisseur Michael Geliot in einem abstrakten weißen Raum stattfinden (Bühne: Ralph Koltai), fast nur noch ein szenisches Konzert in ganz unnötig bunten Kostümen. Den Auftritt des Gefangenenchores beeinträchtigt erst durch technische Umständlichkeit in der musikalischen Wirkung: die Gefangenen kletterten aus Gräben empor, deren Gitterbedachung mittels eines aufwendigen Räderwerkes hochgehievt wird. Viel Technik auch für die Schlußverwandlung: Florestans Kerker kippt langsam unter die Erde. Der Aufwand bleibt sinnlos, denn eine Atmosphäre schaffende Szene gelingt nicht, bloß kahle, nüchterne Mauern als toter Rahmen für eine Regie der realistischen Kleinmalerei. Von Konzept, von Deutung keine Spur.
Bei Ingrid Bjoners Leonore mußte man anfangs bangen, doch dann wuchs sie in die Rolle, steigerte die Intensität ins Grandiose. James King hatte für den Florestan mehr tenoralen Glanz als Ausdruck, Leif Roar gab dem Pizarro fahle Verruchtheit, Franz Crass als Rocco zeichnete ein Charakterporträt des kleinbürgerlichen Mitläufers, Adrienne Csengery gab als Marzelline mit glockenhellem lyrischen Sopran ein vielversprechendes Münchner Debüt, Willi Brokmeier sprang als Jacquino stimmgewandt im letzten Augenblick ein. Den Minister ex machina adelte Dietrich Fischer-Dieskau, hier triumphiert das Edelmenschliche schon in der Stimme. Der Beifall war lebhaft, aber ohne Überschwang; dem Regisseur und seinem Bühnenbildner schallte ein wüstes Buh-Konzert entgegen. Daß auch der Dirigent ausgebuht wurde, zeugt diesmal von verstopften Ohren.
Hans Krieger
__________________________________
Nürnberger Zeitung, 30. Juli 1974
"Fidelio" in München
Fehlgriff aus Cardiff
Der Engländer Michael Geliot ist gescheitert
Was mag den Intendanten der Bayerischen Staatsoper, Günther Rennert, wohl bewogen haben, den 40jährigen Engländer Michael Geliot mit der Inszenierung der zweiten Festspiel-Premiere zu betrauen? Michael Geliot, ursprünglich noch als Mike Geliot angekündigt, ist Rennert als Regie-Assistent bei den Opernfestspielen in Glyndebourne begegnet. Geliot hat, später zum künstlerischen Leiter der Waliser National-Oper in Cardiff avanciert, Opern und Schauspiele inszeniert, aber noch nie Beethovens "Fidelio".
Das Unternehmen mußte von vornherein als Wagnis gelten. Was immer Rennert als künstlerischer Berater der Glyndebourne-Festspiele an Regie-Assistenten kennenlernt, taugt noch lange nicht für eine Festspiel-Inszenierung in München. Geliot ist mit Beethovens Oper einfach nicht fertig geworden. Diese Aufgabe war für ihn zu schwer. Rennert entschloß sich nach der Hauptprobe, selbst noch einzugreifen. Aber vor allem der Schluß war nicht mehr zu retten.
Geliot hatte sich von seinem Landsmann Ralph Koltai, mit dem er in England zusammengearbeitet hat, das Bühnenbild entwerfen lassen. Im ersten Aufzug ahnte man noch nichts Unzulängliches. Marzelline, die Tochter des Kerkermeisters Rocco, bügelt ihre Wäsche inmitten eines quadratischen Gefängnishofes, eingerahmt von trostlosen modernen Betonmauern eines uneinnehmbaren Bunkers. Nur ein einzelner trister Baum erinnert daran, daß es irgendwo noch grünendes Leben gibt.
Ganz schlimm aber ist der Schluß. Die Kerkerszene mit der Rettung Florestans durch seine heroische Gattin tief unter der Erde geht bei offener Bühne direkt in den Schlußschauplatz vor dem Staatsgefängnis über: Das Kellergewölbe versinkt, die Decke senkt sich, und ihre Oberfläche bildet den freien Platz, wo Florestan seinen Freund, den Minister, wiederfindet, der der Gerechtigkeit schließlich zum Siege verhilft. Kaum ist das Deckengewölbe niedergesunken, stürzen auch schon Gefangene, vom Regisseur grob gruppiert, nach rechts vorn, während links und rechts auf weißgetünchten Emporen regungslos schauendes Volk sich aufgebaut hat. Die Menge im Hintergrund darf noch einmal als geschlossene Phalanx nach vorne rücken. Nirgends ist eine Motivation für Bewegung oder Beharren zu erkennen. Geradezu komisch wirkt es, wenn der Minister den mordlüsternen Gefängnisgouverneur nur einfach mit dem Zeigefinger barsch von der Szene weist; Pizarro verschwindet seitlich im Hintergrund. Wo bleibt die sichere Sühne für seine Verbrechen, wo die Überantwortung des Bösewichts an die strafende Gerechtigkeit?
Musikalisch dagegen geriet "Fidelio" nicht so übel. Das Bayerische Staatsorchester unter Wolfgang Sawallisch spielte diszipliniert. Sawallisch hielt Bühne und Orchester, wenn auch mit Einschränkungen, gut zusammen. Auch die Besetzung konnte sich hören lassen. Eine großartige Entdeckung ist die junge Ungarin Adrienne Csengery von der Budapester Staatsoper als Marzelline, ein lyrischer Sopran von großem Wohlklang und eminenter Kraft, mit der sie mühelos das Ensemble überstrahlte. Gewichtigen Anteil am musikalischen Erfolg hatte auch Franz Crass mit seinem fülligen Baß als betulicher, allzu willfähriger Kerkermeister Rocco. Auch die übrige Besetzung mit Leif Roar (Pizarro), Ingrid Bjoner (Leonore), James King (Florestan) und Dietrich Fischer-Dieskau (Minister) hatte durchaus Festspielniveau.
Am Schluß gab es für die Sänger und den Dirigenten viel Beifall, für den Regisseur und seinen Bühnenbildner massive Buhchöre.
Hans Lehmann
__________________________________
Südwest-Presse, Ulm, 30. Juli 1974
Zucht im Zuchthaus
Licht und Schatten bei einem Münchner "Fidelio"-Festspielabend
"Nehmen wir doch wieder die alten Kulissen, Herr Professor!" wünschte sich Ingrid Bjoner von Wolfgang Sawallisch, als sie im Münchner Nationaltheater für den neuen Festspiel-"Fidelio" probte. Es hatte sich herausgestellt, daß die neuen Kulissen von Ralph Kotai den Sängern Mühe machten, das Orchester zu hören. Es macht aber auch, wie es sich in der Premiere zeigte, den Zuhörern Mühe, die Sänger zu hören - namentlich im ersten Akt.
Welche Kulissen aber kann die Bjoner gemeint haben, fragt sich der Besucher: Entweder der Professor hat sie forträumen lassen, oder es ist der Rupfen. Im Gefängnishof ist bloß ein Lindenbaum übriggeblieben, spärlich beblättert; links und rechts am Boden befinden sich riesige Kanalgitter, unter denen die Sträflinge schmachten wie lauter dritte Männer. Die Gitter können mittels Wagenrädern hochgehievt werden, was einigermaßen komisch aussieht. Ringsum aber versperren (vermutlich schallschluckende) graue, glatte Rupfenwände die Aussicht auf den Himmel von Sevilla - es ist, als ob man sich in einer documenta-Ausstellung befände, aus der die Kunstgegenstände entfernt wurden. Hier stellt sich eben nur einer aus: Don Pizarro, Mordbefehlshaber und Faschist. Und um ihn lauter graue, geschreckte Mäuse. So sieht es Michael Geliot, der Regisseur aus England.
Im zweiten Akt dann Kotais Bühnenbild-Gag: Beim Trompetensignal, das Don Pizarros Mord an Florestan vereitelt, fährt die Kerkergruft in die Tiefe, knarrend senkt sich die Kerkerdecke zu Boden und wird zum Podest der nach Freiheit und Licht dürstenden Zuchthausinsassen. Diese eindrucksvolle Verwandlung auf offener Bühne, eine Blitzverwandlung von der Nacht zum Licht, läßt die dritte Leonoren-Ouvertüre verschmerzen, die sonst den Bühnenumbau überbrückt: um ein politisches Wunder geht es hier, um ein Opernwunder in der Person eines Ministers, der die Freiheit bringt.
"Im Reich der Freiheit gibt es keine Minister. Die Oper ist das Reich des Scheins", hat Hans Magnus Enzensberger für die Bremer "Fidelio"-Fassung formuliert, in der ein Zwischentext die Dialoge der handelnden Figuren ersetzt. Münchens "Fidelio" ist nun der erste nach dem vielzitierten in Bremen, und daher beschattet von der "modernen" Lösung Enzensbergers. Ist ein Dialog-"Fidelio" fortan unmodern? Mit Sicherheit nicht, da es ja geradezu wieder modern wird, Geschichten auf dem Theater zu erzählen, die Kommentare aus der Handlung selbst abzuleiten und die Verfremdungen sein zu lassen. Schlüsselfigur für Geliot in München ist der Gefängniswärter Rocco: ein Mitläufer, der genau weiß, was er tut.
Die Dialoge sind geschickt verknappt, die Sänger mit Erfolg gemahnt, beim Sprechen von den Stelzen herunterzusteigen. Leider passieren einige unlogische Dinge, weil Geliot Sänger nicht herumstehen sehen kann und sie lieber dreimal heraus- und hereinzitiert wie Wetterhausmännchen im April. Das führt dann etwa dazu, daß Jacquino (Willi Brokmeier) erklärt, ihm sträube sich das Haar, ohne wissen zu können, warum. Und daß die Gefangenen nur kurz mal eben durch eine Hintertür verschwinden, als seien sie in die Kantine geladen, um dann brav wieder zur Gittertreppe zu schleichen, ist auch nicht eben einleuchtend, sondern Geheimkommandosache der Regie. Man tut’s, weil’s verlangt ist. Überhaupt herrscht Zucht in diesem Zuchthaus; bei der APO waren diese Gefangenen bestimmt nicht.
Gesungen wird (sieht man einmal von den Rupfen-Schallmauern ab, die die Stimmen stumpf machen) ganz außerordentlich gut von Ingrid Bjoner (Titelrolle), James King (Florestan), Franz Crass (Rocco) und Leif Roar (Pizarro): vier Sänger, die ihre Wagner-Stimmen so beherrschen, daß sie auch in exponierten Lagen zu Diminuendos fähig sind und Beethovens "ruhige Begeisterung" artikulieren können - eine Ekstatik von innen. Fischer-Dieskau ist ein würdevoller, ganz auf humanen Ausdruck bedachter Amnestieminister.
Sawallischs Beethoven ist nicht Furtwänglers Beethoven. Zu Vulkanausbrüchen kommt es nicht, Misterioso-Unheimlichkeiten fehlen. Es wird kraftvoll und präzis musiziert. Die Akte gleichen symphonischen Sätzen. "Fidelio" klingt "klassisch" so. Ein Beethoven für Aufgeklärte.
Gerhard Pörtl
__________________________________
Mittelbayerische Zeitung, Regensburg, 29. Juli 1974
Münchner Festspiele
"Fidelio" von Beethoven
Als zweite Festspielpremiere
Steigerung privater Schicksale zum gesellschaftlichen Konflikt, Transzendierung der Gefühle zu Ideen - die Neuinszenierung des englischen Nachwuchsregisseurs Michael Geliot leistete diese Aktualisierung der politischen Allegorie nur bruchstückhaft. Mitschuld trägt die Ausstattung Ralph Koltais, der in den Kostümen Spätabsolutismus und Restaurationszeit beschwor. Der ganze erste Akt spielt aber in einem kahlen Betongeviert des 20. Jahhunderts. Ihm folgt ein völlig realistischer Kerker mit Stroh und Steinen, dessen hochragende schräge Decke sich dann in einer glänzenden Entsprechung zur musikdramatischen Entwicklung herabsenkt: die Kerkerwelt versinkt, die Szene weitet sich zu einem weiß ausgeschlagenen, hell ausgeleuchteten irrealen Raum, zur Utopie der Verbrüderung.
Geliot hat sich besonders die Figur des Rocco vom Buffo-Dasein zur Allgemeingültigkeit des zwar zur Einsicht fähigen, aber dennoch dienenden "Mitläufers" umgezeichnet: leutselig, ein wenig selbstgefällig, zum Schwarzen neigend, mit Mut in kleinen Dingen, sonst aber duckende Anpassung. Franz Crass, spielfreudig und beweglich wie selten, setzte dieses Konzept voll um und wurde am meisten gefeiert. Ein Teil des Ensembles - Ingrid Bjoner (Leonore), James King (Florestan) - hatte hohes Niveau: Leif Roar (Pizarro) ließ für Momente in der Stimme brutale Roheit aufblitzen; Dietrich Fischer-Dieskau als bewußt unattraktiver demokratischer Minister überzeugte in der Beschwörung einer besseren Welt nicht völlig. Den Gefangenenchor (Einstudierung: Wolfgang Baumgart) brachte Geliot durch einen zu schnellen Auftritt zum herrlichen Leidensweg-Adagio der Musik um seine dichte Wirkung. Überwältigung durch die Musik kam erst in der ohnehin einzigartigen Kerkerszene auf und Feuer entzündete Wolfgang Sawallisch dann nur noch im Schlußbild. Eine gute Fidelio-Aufführung - aber ist das nicht zu wenig?
wdp.
__________________________________
Mannheimer Morgen, 3. August 1974
Münchner Reprisen mit Surrealismus aus Paris
[...]
In wenigen Tagen geht die Bayerische Staatsoper in Ferien, ein Repertoiretheater, das drei Wochen lang Münchner Festspiele veranstaltet und noch in den letzten Spieltagen zwei Premieren losgeschickt hatte. Keine der ans Spielzeitende gedrängten Erstaufführungen und Neuinszierungen erreichte das Gewicht der von Dietrich Fischer-Dieskaus breitem, vitalen Humor getragenen Eröffnungspremiere "Falstaff", der man allenfalls ankreiden konnte, Günther Rennerts Regie sei um einiges zu laut und buffonesk gewesen. Wolfgang Sawallisch hatte sich von der gewiß nicht alleinseligmachenden Toscanini-Tradition distanziert und einen deutschsprachigen Verdi in gemäßigten Zeitmaßen und mit Rücksicht auf die lyrischen Elemente dirigiert.
Ein bitterer Fehlschlag war die Neuinszenierung des "Fidelio": betulicher Realismus, von dem Engländer Michael Geliot (Cardiff) ungeschickt in abstrakt flächige Bühnenbilder von Ralph Koltai gestellt. Der Abend schien verhext gewesen zu sein. Das aufgebotene Optimum an Münchner Sängern (Ingrid Bjoner, James King, Franz Crass) blieb matt. Akustische Divergenzen zwischen Bühne und Orchester nötigten Sawallisch dazu, den vielen unerwarteten Schwierigkeiten mit bloßer Schlagtechnik entgegenzutreten und seine schlanke, trockene, von hurtigen Zeitmaßen bestimmte Beethoven-Interpretation auf einen günstigeren Tag zu verschieben. In der Pause zeichnete sich ein Debakel ab. Zwanzig Minuten vor Schluß kam die Wende: In der kleinen Rolle des Ministers betrat Fischer-Dieskau die von spanisch kostümierten Chören bevölkerte Bühne und richtete ein tönendes Monument der Humanität auf. Seine Suggestion war so stark, daß man das Vorausgegangene bereitwillig vergaß und sich zu einem heftigen Applaus für die Sänger entschloß. Die Verantwortlichen der im argen liegenden Szene bekamen den Unwillen des sonst gutmütigen Publikums zu spüren.
[...]
Karl Schumann
__________________________________
Trierischer Volksfreund, 1. August 1974
Ein fader "Fidelio"
Mißglückte Neuinszenierung bei den Münchner Festspielen
Ja, auch das gehört leider zu den mit "Falstaff" so glänzend begonnenen und mit Reprisen-Preziosen aus den vergangenen Jahren angereicherten Münchner Opernfestspielen: Trotz einer hochkarätigen Besetzung, trotz Wolfgang Sawallisch am Pult, ein Regisseur, Michael Geliot aus England, der mit "Fidelio", Beethovens einziger und ergreifender Oper, nichts, aber schon rein gar nichts anzufangen wußte.
Unkenrufe gab es schon einige Tage vor der Premiere mehr als genug: Die Sänger sollen sich beim Intendanten über den Regisseur beschwert haben, der Regisseur wiederum beschwerte sich beim Intendanten über angeblich zu wenig Probenzeit und über die "lahme Münchner Technik", der Dirigent Wolfgang Sawallisch monierte, daß der schalldämpfende Teppich, den der Bühnenbildner Ralph Koltai dieser Neuinszenierung verpaßte, die Stimmen der Sänger "verschlucke", und als der Regisseur schließlich mit dem Bühnenbild auch nicht zurechtkam, eilte Intendant Rennert, der in Salzburg gerade "Die Frau ohne Schatten" probte, nach München, um in die Inszenierung "helfend einzugreifen" (wie er es ausdrückte), um das Allerschlimmste, ein "Fidelio"-Fiasko, zu verhindern.
Doch viel schien Rennert bei der Generalporobe nicht mehr ändern zu können, der Karren lag bereits zu tief im Graben - und dem Premierenpublikum blieb denn auch nicht viel anderes mehr übrig, als - je nach Temperament - sich über soviel Regie-Dilettantismus zu wundern, zu schütteln oder zu ärgern. Die Buhsalven - nur von spärlichem Bravo durchsetzt -, die dem Regisseur beim Schlußvorhang entgegendonnerten, waren denn auch dementsprechend.
Unentschlossen zwischen Realismus und Abstraktion hin-. und herpendelnd, sich allein auf eine leere Bühne verlassend, die er aber nicht mit Spiel, mit Leben zu füllen wußte, ohne Beethovens idealistisches, humanes Anliegen im entferntesten deutlich zu machen, ließ der Regisseur hier einen faden, farblosen, langweiligen "Fidelio" über die Bühne des Münchner Nationaltheaters rollen. Daß es in dieser Oper immerhin um Freiheitssehnsucht, um Streben nach Gerechtigkeit geht, bei Michael Geliots Regie wurde man es nicht gewahr. Dazu von Personenführung, von Personenregie, von differenziertem Herausarbeiten der einzelnen Charaktere keine Spur: Wer gerade zu singen hat, tritt vor an die Rampe, wer nicht, tritt zurück. Basta. Und die Chöre stehen herum wie müde Passantengruppen, die auf den nächsten Omnibus warten. Beim Schlußchor gar, nachdem der Kerker bei offenem Vorhang in den Bühnenboden verschwunden ist, stürmen die freigelassenen Gefangenen nicht auf die Bühne - in die Freiheit -, nein sie stehen bereits da, harrend der Dinge und des Zeichens des Dirigenten, daß sie nun zu singen haben.
Allerdings entschädigte die musikalische Seite der Aufführung. Mit welch dramatischer Wucht, mit welch innerer Anteilnahme Ingrid Bjoner die Leonore sang, das hört man selbst im verwöhnten München wirklich selten; James King war ein anfangs gedämpfter, später aber voll aussingender Florestan; Dietrich Fischer-Dieskau lieh dem Minister Don Fernando und Leif Roar dem Gouverneur Pizarro Stimme und Gewicht. Als Kerkermeister Rocco brillierte Franz Crass und als seine Tochter Marzelline die von Rennert in Budapest entdeckte Adrienne Csengery, die in den Höhen noch etwas forciert sang, im ganzen aber einen ungemein reinen, lyrischen Sopran besitzt. Wolfgang Sawallisch wirkte bei der Ouvertüre (Nr. 4, E-Dur) etwas nervös - was nicht verwundert bei dem ganzen Kladderadatsch der vorhergegangenen Probentage -, kehrte die tragisch-heroischen Akzente dann aber mit der bei ihm schon beinahe sprichwörtlichen Verve hervor.
Alles in allem: Der erste (und hoffentlich einzige) Regie-Reinfall bei den an Höhepunkten überreichen diesjährigen Münchner Festspielen.
Hannes S. Macher
__________________________________
Generalanzeiger, Bonn, 7. August 1974
Münchner Opernfestspiele 1974:
Im Spannungsfeld des Intendantenwechsels
"Walküre", "Fidelio" und "Falstaff" im Mittelpunkt – Ein Rückblick
[...]
Die Festspiel-"Walküre" hat indes gezeigt, daß Brazdas allzu stimmungsbewegte Lichtspiele die Aufmerksamkeit vom klaren Vortrag der Handlung, vom Spiel der Darsteller eher abzogen, und daß sie recht belastende künstlerische Konfusionen schufen. Ansonsten gingen von der Aufführung (mit Ingrid Bjoner als Brünnhilde und Theo Adam als Wotan) starke Wirkungen aus, die freilich nicht zuletzt durch die großartig verwirklichte Musikdramatik (Wolfgang Sawallisch) geschaffen wurden.
Zumindest vor Beginn des zweiten Aktes vermochte die Fidelio-Aufführung solche Wirkung nicht zu erreichen. Hier befremdeten die stilistisch fragwürdigen Szenarien, die Ralph Koltai für den nicht unbedingt überzeugenden englischen Gast-Regisseur Michael Geliot geschaffen hatte. Beethoven-Dimensionen drangen in das Spiel erst ab der Kerkerszene ein. Die eröffnende Florestan-Arie wurde ergreifend von James King gesungen; auch Ingrid Bjoner (Leonore) und der stimmlich bemerkenswert profilierte Leif Roar (Pizarro) konnten hier erst zu voller dramatischer Entfaltung finden. Außer ihnen hatten vorher schon Franz Crass’ baßgewaltiger und spielfreudiger Rocco, besonders aber auch die beherzte und gesanglich erstaunlich begabte Ungarin Adrienne Csengery (Marzelline) die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Geliots Regie-Konzeption ging von der überaus begrüßenswerten Überzeugung aus, daß zwischen Kerker und letztem Chorbild eine Pause nicht eingelegt werden dürfe. Die szenische Realisierung allerdings war auch hier nicht geradezu umwerfend geglückt. Die von Wolfgang Baumgart betreuten Chöre der großen Schluß-Apotheose freilich kamen grandios wie gewohnt. Das Geschenk des letzten Bildes war der Minister des Dietrich Fischer-Dieskau, dessen ausgesprochener Schöngesang und dessen darstellerische Wärme dem ungeheuerlichen Gedicht von menschheitlichem Sieg und menschlicher Verbrüderung eine edle Rundung gaben.
[...]
To Burg
__________________________________
Oberbayerisches Volksblatt, Rosenheim, 30. Juli 1974
Zweite Münchner Festspielpremiere: Beethovens "Fidelio"
Zur Hauptfigur hat Rocco nicht das Zeug
Das englische Team Geliot/Koltai liefert eine musikfremde Inszenierung / Auch Sawallisch bereitet eine Enttäuschung
An Beethovens "Fidelio" wurde und wird viel herumgedoktert. Und zwar von Regisseuren, die sich, statt mit der Musik, viel zu sehr mit dem Text befassen. Von ihm her gesehen, haben sie ja recht: das Libretto ist, gemessen an der Größe des Sujets, unbedarft formuliert. Also hat man die gesprochenen Dialoge durch themabezogene Lyrik und andere Texte ersetzt, hat man - zuletzt in Nikolaus Lehnhoffs Bremer Version - einen Sprecher eingeführt.
Weil der "Fidelio" auch von Gefangenschaft handelt, wurde er auf konkrete politische Situationen bezogen. Rocco, der Mitläufer, geriet ins Schußfeld: im Beethoven-Jahr (1970) stellte ein Schreiber alarmierend fest, er sei "die größte Gefahr für die Menschheit". Auf diese Figur fixierte sich auch Michael Geliot, künstlerischer Leiter der Welsh National Opera in Cardiff, von dem hierzulande noch niemand etwas gehört hat, der dennoch das Werk für die zweite Münchner Festspiel-Premiere inszenieren durfte.
Selbstgefälliger Untertan
Rocco "ist für mich die Hauptfigur", teilte Geliot mit. Was ein Irrtum ist und Geliots Privatsache geblieben wäre, hätte Rennert ihn nicht von England nach München geholt mit dem Auftrag, seine erste "Fidelio"-Regie dem Nationaltheater zu überlassen. Es kam eine peinliche, unintelligente, biedere, also fast nicht mehr diskutable Aufführung zustande, die nur von einem engagierten Dirigenten halbwegs hätte gerettet werden können. Doch Wolfgang Sawallisch blieb uninteressiert, um nicht zu sagen kaltschnäuzig.
Geliot stürzte sich auf alle nebensächlichen Banalitäten, die das Libretto zu bieten hat. Um bei Rocco zu bleiben: er wird beinahe schmierenhaft zum selbstgefälligen Untertan aufgeblasen, zum barschen Schnauzbart (in Hermann-Prey-Maske). Wenn Leonore die neuen Handschellen bringt, fragt er nicht: "Wieviel kostet das alles zusammen?" - so der Wortlaut im Reclam-Taschenbuch -, sondern er fordert schnarrend: "Die Rechung bitte!" Während der Gold-Arie zündet er sich eine Pfeife an, um damit dozierend herumzufuchteln.
*
Diese Regie ist bis zum Unerträglichen und oft auch bis zur Lächerlichkeit amusikalisch. Was passiert zum Beispiel im ersten Quartett? Im Text geht es um Marzellines Liebe zu Fidelio, um Leonores "namenlose Pein", Roccos väterliche Heiratstaktik, Jacquinos Eifersucht. Aber die Musik geht weit über den Anlaß hinaus, läßt sozusagen die Zeit stillstehen. Beethovens Inspiration muß von der ersten Zeile, "Mir ist so wunderbar", entzündet worden sein - hier erhält mit rein musikalischen Mitteln Leonore jenen Nimbus, jene Aura des Außerordentlichen, wie sie Bühnenheldinnen und -helden brauchen.
Geliot zerstört diese Passage völlig, indem er Rocco mal das eine, mal das andere Bein vorstellen, über der aufgeworfenen Brust die Arme verschränken, ihn gestikulieren läßt. Er geht noch weiter: Rocco, der in diesem Quartett auch Nebenstimme zu singen hat, muß drauflos dröhnen, sich stimmlich in den Vordergrund schieben. Ein sensibler Dirigent hätte das nicht zugelassen - Sawallisch verhinderte es nicht.
Es ist doch eigentlich eine Binsenwahrheit: Thema des "Fidelio" ist die Liebes- und Rettungstat einer fast übermenschlich wagemutigen, bis zum Äußersten entschlossenen Frau. Eine Utopie vom unbedingten Zusammenstehen, von höchstem Ethos - deshalb allein geht diese Oper "in die Tiefe des Herzens". Welchen Stellenwert haben da Rocco, Marzelline, Jacquino, sogar Pizarro? Sie bedeuten nicht viel mehr als dramaturgische Gebrauchsgegenstände, die Handlung ermöglichen.
*
Vor der Premiere gab es einiges Aufsehen, als bekannt wurde, daß Rennert in vorletzter Minute in die Regie eingriff. Offenbar wegen ungelöster bühnentechnischer Probleme mit Ralph Koltais Szenereie. Wir sehen im ersten Akt ein weites, ummauertes Viereck, darin Baum, Bügeltisch und Stuhl; im zweiten zunächst eine Art Remise mit Vordach, das sich - "Straße nach oben, in die Freiheit", so Geliot - nach der Kerkerszene wackelnd nach unten senkt in ein weißes, hell beleuchtetes Nichts.
Das alles gibt nichts her, schafft weder die Illusion des Eingeschlossenseins, noch kommt der strahlende Effekt der plötzlich sich öffnenden freien Welt heraus. Ein plattes Saubermann-Bühnenbild, im ersten Akt zu beiden Seiten bestückt mit Gittern, die sich hochdrehen lassen, damit die Gefangenen aus ihrer Souterrain-Behausung aufsteigen können.
Ha! Der Minister!
Der schön singende, über die Bühne verteilte Chor wittert nach dem Aufstieg seine schauspielerische Chance: jeder, ob hingestürzt oder stehend, mimt auf Teufel komm raus Häftlings-Elend. Marzelline reicht einstweilen den Allerärmsten ein Getränk, und Leonore schleicht sich nach unten, um schnell mal nach Florestan zu forschen, von dem sie doch weiß, daß er in einem besonderen Kerker liegt.
*
"Ha! Der Minister!" ruft Pizarro aus, nachdem ihm Leonore die Pistole auf die Brust gesetzt hat. "Ha! Fischer-Dieskau!" dachte man erleichtert und erwartungsvoll. Der spielt dann allein durch seine Ausstrahlung alle anderen zur Seite. So opulent war diese kleine Rolle wohl noch nie besetzt: ein großer Herr tritt auf, souverän, mit lebhaft sprechender Miene und fragloser Autorität. Beinahe gotthaft, dieser allerbeste Umgangsformen zeigende Deus ex-machina.
Fischer-Dieskaus Sänger-Kollegen machen es einem fast alle schwer, sich zu begeistern. Ingrid Bjoner (Leonore) kämpft zunächst mit stimmlichen Schwierigkeiten, mogelt sich durch die Läufe ihrer Arie hindurch. Vielleicht störte sie die Regie: immer wieder muß sie trotzköpfchenhaft mit dem Fuß aufstampfen, werden ihr wildentschlossene Gänge abverlangt. Im zweiten Akt kommt sie in Form, erzielt sie leuchtende Spitzentöne, dramatische Intensität.
Franz Crass (Rocco) spielt und singt wie von Geliot befohlen. Den Pizarro gibt Leif Roar, der die Dialoge ins Unverständliche verschnarrt, dessen Soli vermutlich der überschnellen Tempi wegen gelegentlich etwas Bellendes haben. Adrienne Csengery (Marzelline), die Neuerwerbung aus Ungarn, macht durch uncharmante Kratzbürstigkeit auf sich aufmerksam - was wiederum an der Regie liegen dürfte -, sang mit etwas scharfem Sopran. Im Finale gelingt es ihr, die Lauteste zu sein.
Bravouröser James King
James King hat seine großen Momente in der Florestan-Arie. Er bringt sie musikalisch konzentriert, stimmlich sicher, bewältigt die vertrackten hohen Stellen bravourös. Beim Schluß-Tableau steht er dann recht hilf- und ausdruckslos herum. Nicht zu vergessen: Willi Brokmeier singt den Jacquino, Lorenz Fehenberger und Gerhard Auer geben die Solo-Gefangenen.
Für den Verbleib von Wolfgang Sawallisch als Generalmusikdirektor der Bayerischen Staasoper läuft an seinen Festspiel-Abenden unter dem Portikus des Nationaltheaters eine Unterschriften-Aktion. Er macht für sie die allerschlechteste Reklame. Daß der "Fidelio"-Text duch die Partitur beglaubigt, ja überhöht wird, führt er nicht vor. Er legt lediglich schnittige Tempi vor, bleibt knochentrocken, kriegt aus dem Orchester unpräzises Spiel nicht raus. So wird Beethovens Musik versimpelt, die manchmal von recht unkomplizierter Machart erscheint, wenn nicht äußerste Spannung, heftiger Impetus und Enthusiasmus investiert werden.
Im zweiten Akt holt Sawallisch auf, gewiß - es wurde allerdings nur besser, aber nicht gut. Wie schon die Ouvertüre, scheint er den Schluß des Kerker-Terzetts auf den Radetzky-Marsch zuzudirigieren, und im Finale, wo zwischen Soli und Tutti sorgfältig differenziert werden muß, bleibt er bei der bloßen Lautstärke. Eigentlich war man froh, die üblicherweise zwischen dem vorletzten und dem letzten Bild gespielte dritte Leonoren-Ouvertüre nicht auch noch hören zu müssen.
*
Rennert dürfte gar nichts anderes übrigbleiben, als diese unmögliche, weil völlig Beethoven-fremde "Fidelio"-Version so schnell als möglich wieder abzusetzen. Sie hatte beim Publikum wenig Resonanz: kaum Szenenbeifall, am Schluß mäßiger Applaus, der sich nicht - wie sonst üblich - der Buh-Chöre wegen steigerte. Sie galten offenkundig Geliot und Koltai.
Hans Göhl